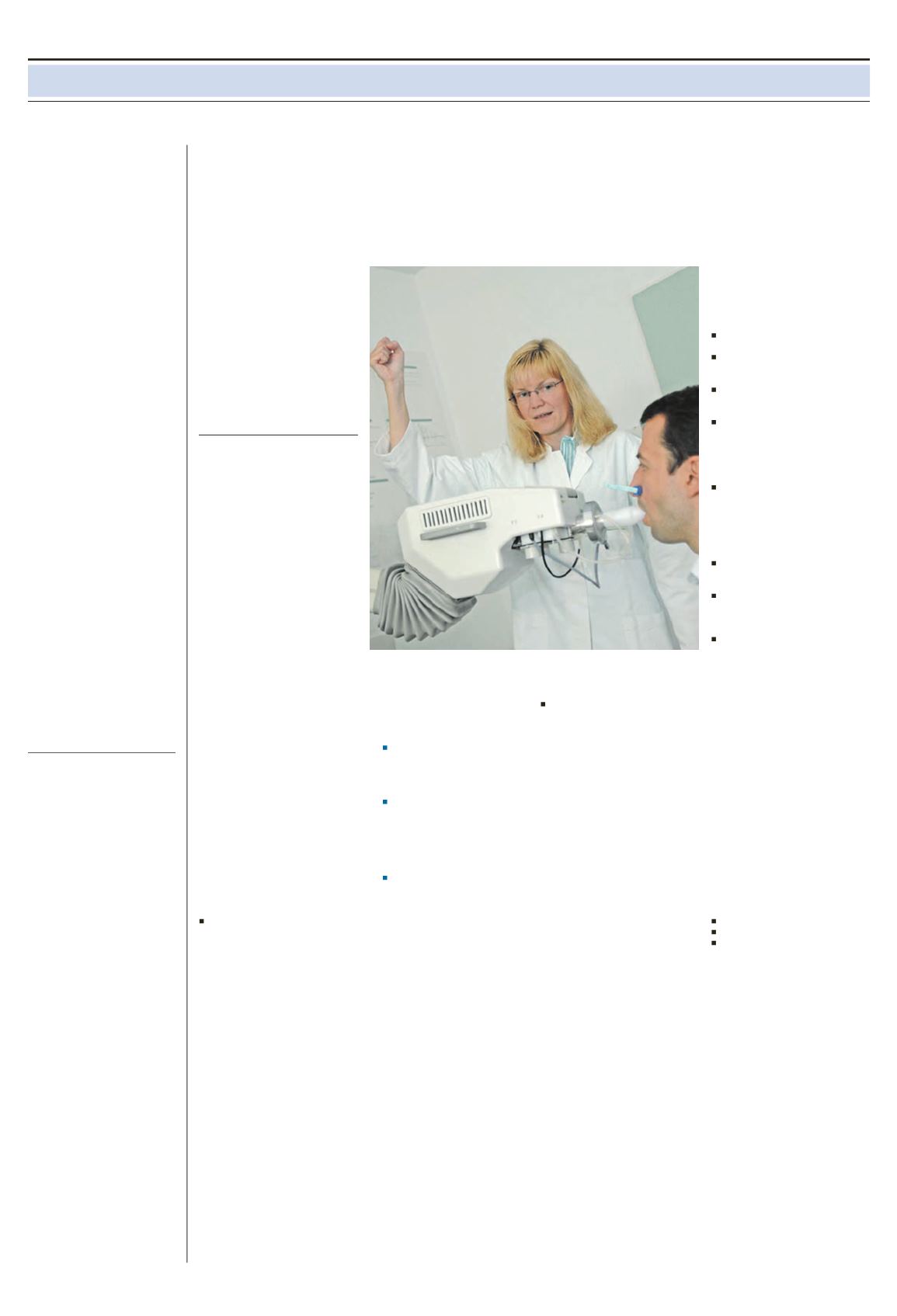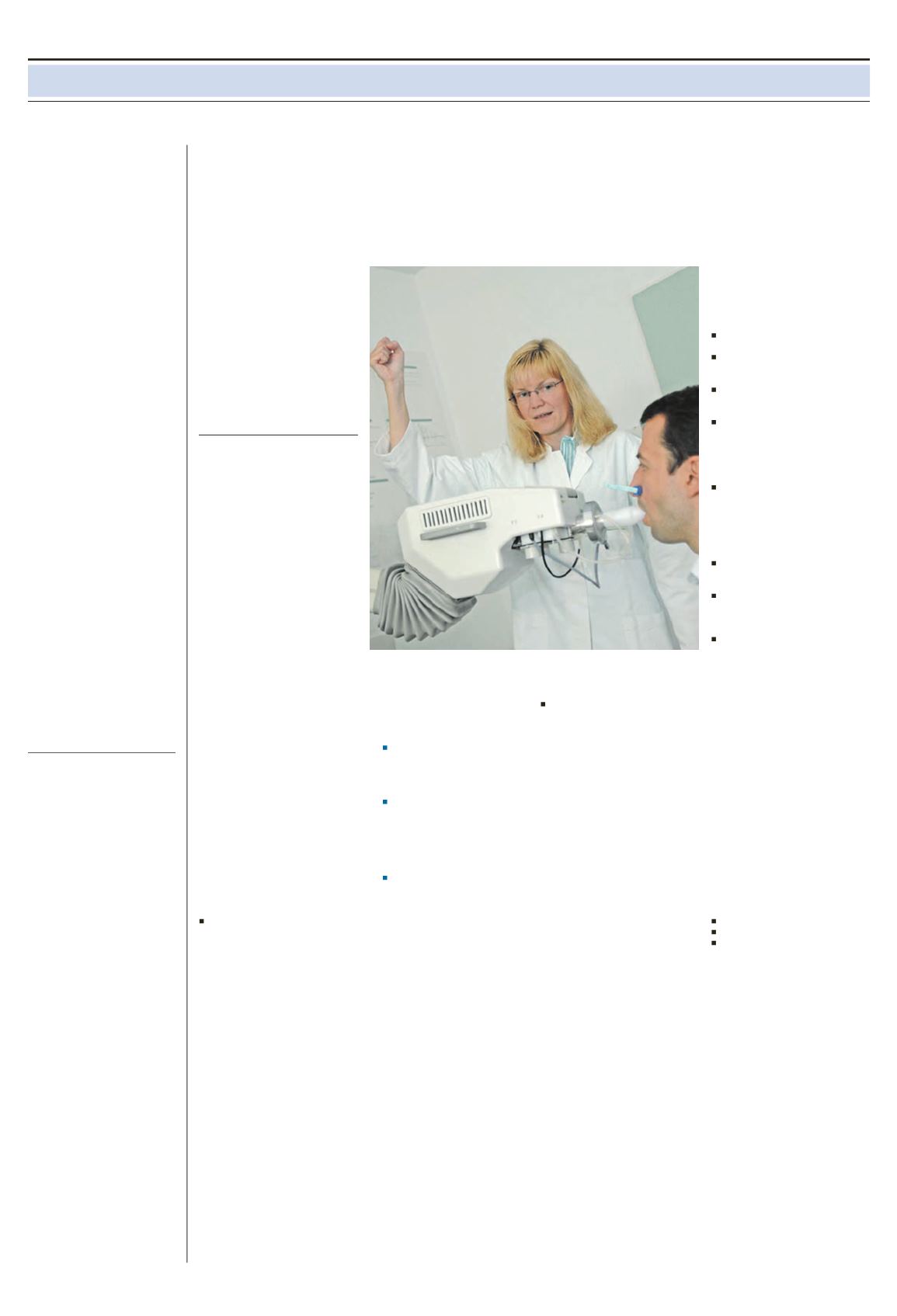
Viele Flüchtlinge, die in Deutsch-
land ankommen, müssen ja ihre
Lunge röntgen lassen, um eine
Tuberkulose auszuschließen. Ob-
wohl die Fallzahlen im Vergleich
zum Vorjahr um rund 30 Prozent
gestiegen sind, bleibt die Krankheit
hierzulande aber selten. Experten
sehen trotz des Anstiegs kein erhöh-
tes Ansteckungsrisiko für die Bevöl-
kerung.
Nach Angaben des Robert
Koch-Instituts in Berlin (RKI) ver-
dreifachte sich die Zahl der Erkran-
kungen bei Aufnahmeuntersuchun-
gen für Asylbewerber auf rund
1250 (Stichtag: 1. März 2016).
2014 waren es gut 400 gewesen.
Die Zahl der Tuberkulose-Fälle ins-
gesamt stieg in Deutschland auf
5865, wie das RKI mitteilte. Erst-
mals seit Mitte des 20. Jahrhun-
derts erlebe man eine Umkehr des
bisher rückläufigen Tuberkulose-
trends. „Die Strategien, die wir zur
Eindämmung der Tuberkulose bis-
her hatten, scheinen nicht mehr zu
funktionieren“, wird Martin Priwit-
zer, Vizepräsident des Deutschen
Zentralkomitees zur Bekämpfung
der Tuberkulose, in einer Mittei-
lung der dpa zitiert. Heute gebe es
zwar kaum noch Erkrankungen,
allerdings seien Risikogruppen
übrig geblieben, darunter alte Men-
schen, Suchtkranke und eben auch
Zuwanderer aus Ländern mit vielen
Tbc-Fällen.
Dennoch werde die Tuberkulose
in absehbarer Zeit auch durch den
Zuzug von Migranten nicht zu einer
häufigen Infektionskrankheit in
Deutschland werden, so der Exper-
te Professor Christoph Lange vom
Forschungszentrum Borstel.
(dpa)
Steigende Zahl
von Tb-Fällen in
Deutschland
INFEKTIONEN
Forscher konnten zeigen, dass bei
Allergien ausgeschüttete Botenstof-
fe nicht nur Zellen des Immunsys-
tems, sondern auch Atemwegsepi-
thelzellen verändern, teilt das
Helmholtz Zentrum München mit.
Die Forscher behandelten die
Zellen mit IL-4 und IFN-gamma
und beobachteten, wie sich die
Genaktivität veränderte (Mucosal
Immunol 2015; online 18. Novem-
ber). Wie bereits für Immunzellen
bekannt, war IL-4 in der Lage, eine
Aktivierung von Genen der Th-2
Immunantwort auszulösen, die zur
Entstehung von Asthma beiträgt.
IFN-gamma wirkte diesem entge-
gen, indem es das Ablesen von Th-
1 Genen begünstigte. Exemplarisch
beschreiben die Autoren das Mole-
kül IL-24, das von IL-4 herauf- und
von IFN-gamma heruntergeregelt
wird. IL-24 könnte daher laut den
Forschern möglicherweise als Bio-
marker für allergische Entzündun-
gen des Atemwegsepithels dienen.
Um die Relevanz der Ergebnisse
zu überprüfen, untersuchten die
Forscher Rhinitis-Patienten. Es
zeigte sich, dass der Effekt ebenfalls
an den Nasenschleimhäuten der
Patienten zu beobachten ist, heißt
es in der Mitteilung. Die Autoren
schließen daraus, dass die Regulati-
on von Epithelzellen in der allergi-
schen Erkrankung in einer Art Fin-
gerabdruck der Allergie endet.
(eb)
Allergie prägt
das Epithel von
Atemwegen
RHINITIS
Nicht immer sind es Nikotin und
Teer, die der Lunge beim Tabak-
konsum am stärksten zusetzen: Man-
che Menschen reagieren besonders
empfindlich auf Zusatzstoffe, und
davon finden sich auch reichlich in der
Flüssigkeit für die mittlerweile recht
populären E-Zigaretten. Gerade in
den süßlich schmeckenden sogenann-
ten E-Liquids wird häufig die nach
Butter riechende Ketonverbindung
Diacetyl verwendet - eine Substanz,
die für Überempfindlichkeitsreaktio-
nen bekannt ist.
Möglicherweise wurde eine solche
Diacetyl-haltige E-Zigarette einem
60-jährigen Mann zum Verhängnis,
der sich mit Atembeschwerden im VA
Medical Center in White River Juncti-
on vorstellte. Der Mann fühlte sich
sehr schwach und klagte über starken
Husten sowie Schüttelfrost. Kollegen
um Dr. Graham Atkins und Dr. Frank
Drescher fanden jedoch keinerlei ra-
diologische Auffälligkeiten. Sie behan-
delten den Mann mit Ceftriaxon plus
Azithromycin und konnten ihn drei
Tage später in gutem Allgemeinzu-
stand entlassen (Chest 2015; 148
(4_MeetingAbstracts): 83A).
Etwa einen Monat später stellte
sich der Mann mit ganz ähnlichen
Symptomen erneut vor. Dieses Mal
hatte er zudem 38,6 °C Fieber und
war deutlich hypoxisch: Sein Sauer-
stoffpartialdruck lag bei nur 48
mmHg. Die Ärzte vernahmen zudem
Rasselgeräusche und veranlassten er-
neut ein Lungen-CT. Dabei fanden sie
beidseitig im oberen Lungenflügel
milchglastrübe Infiltrate. Die Anamne-
se ergab, dass der Patient vor beiden
Klinikaufenthalten stark aromatisierte
E-Zigaretten geraucht hatte.
Die Ärzte um Atkins und Drescher-
behandelten den Patienten vorsichts-
halber erneut mit Antibiotika. Inner-
halb eines Tages gingen Dyspnoe und
Fieber zurück, nach drei Tagen waren
auch die Infiltrate verschwunden.
Selbst wenn der definitive Beweis
fehlt, so halten die Ärzte eine exogen-
allergische Alveolitis (Hypersensitivi-
tätspneumonitis) verursacht durch
Substanzen im E-Liquid für den wahr-
scheinlichen Auslöser der Beschwer-
den. Sie empfahlen dem Patienten, auf
E-Zigaretten zu verzichten. In der Fol-
gezeit entwickelte er keine weiteren
Lungenbeschwerden; eine CT drei
Monate später war unauffällig.
Diacetyl hat in der Vergangenheit
bereits als mutmaßlicher Auslöser
einer anderen, weit schwereren Er-
krankung, der „Popcorn-Lunge“ für
Aufsehen gesorgt. Dabei handelt es
sich um eine Bronchiolitis obliterans
bei Popcorn-Konsumenten und Arbei-
tern in Popcornfabriken (Popcorn
Worker’s Lung).
(mut)
Ein Mann kommt zweimal
innerhalb eines Monats mit
Lungenbeschwerden in die
Klinik. Grund ist eine akute
Lungenschädigung durch
aromatisierte E-Zigaretten.
Fiebrige Pneumonitis durch E-Zigarette
12
April 2016
BDI aktuell
Medizin
Die belastungsinduzierte Broncho-
konstriktion (BIB) ist oft gar nicht
leicht zu diagnostizieren: Symptome
wie Atemnot, Brustenge, pfeifender
Atmen („Wheezing“) oder Husten
während oder nach körperlicher An-
strengung sind typisch, aber wenig
spezifisch. Vor allem Asthma, aber
auch eine laryngeale Obstruktion
(„Vocal-Cord-Dysfunktion“, EILO)
haben ähnliche Symptome und wer-
den daher oft verwechselt. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass bei Sportlern
sowohl Asthma als auch EILO nicht
selten mit der BIB zusammentreffen,
betonen Experten um Professor James
Smoliga von der High Point University
in North Carolina.
Charakteristischerweise entwickeln
sich die Symptome der belastungsin-
duzierten Bronchokonstriktion binnen
15 Minuten nach der Anstrengung
und klingen binnen einer Stunde wie-
der ab. Danach wird oft eine refraktäre
Phase von ein bis drei Stunden beob-
achtet: In dieser Zeit kann es zu weni-
ger ausgeprägten Symptomen kom-
men, wenn der Patient sich erneut be-
lastet. Dadurch, und auch durch den
FEV
1
-Abfall nach der Belastung, un-
terscheidet sich die BIB vom Asthma.
Allerdings können BIB-Symptome
durchaus auch während des Sports
auftreten.
Indirekter Belastungstest empfohlen
Für diagnostische Sicherheit kann nur
ein Belastungstest in Verbindung mit
einer Spirometrie sorgen, so Smoliga
und sein Team (BMJ 2016; 352:
h6951). Sie empfehlen einen indirek-
ten Belastungstest, bei dem die Auslö-
ser für die Bronchokonstriktion simu-
liert werden, und zwar
durch Einatmen von trockener Luft
während der Belastung („high intensi-
ty exercise challenge“), zum Beispiel in
einer Klimakammer, oder
durch kontrollierte Hyperventilation
mithilfe eines gasgefüllten Zylinders
(eukapnische willkürliche Hyperpnoe).
Die Spirometrie wird vor sowie
mehrmals nach der „Challenge“ (je-
weils im Fünf-Minuten-Abstand)
durchgeführt. Dabei steht ein FEV
1
-
Abfall von mehr als 10 bis 15 Prozent
zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Messpunkten für ein positives Ergeb-
nis. International werden unterschied-
liche Grenzwerte angegeben; beispiels-
weise fordert die European Respirato-
ry Society einen Abfall von mehr als
12 Prozent.
Wer sich nicht an die etablierten
Protokolle halte, riskiere eine „hohe
Rate an falsch positiven Diagnosen“,
warnen Smoliga und Kollegen. Dies
führe dazu, dass oft unnötigerweise
Bronchodilatatoren eingesetzt würden.
Aber auch die Unterdiagnostik sei mit
Nachteilen verbunden: So würden Pa-
tienten wegen ihrer Symptome häufig
ihre sportlichen Aktivitäten einschrän-
ken, obwohl diese ihnen eigentlich zu-
gutekämen.
Achtung, Fallstricke!
Die Autoren listen Fallstricke auf:
Die eingeatmete Luft muss ausrei-
chend trocken sein ( 5 mg H
2
O/l).
Bei der Belastungsintensität müssen
über 90 Prozent der maximalen Herz-
frequenz erreicht werden.
Bei Patienten, die bereits ein Medi-
kament gegen ihre Symptome erhal-
ten, ist ein Bestätigungstest nötig.
Den Spirometer durch einen Peak-
Flow-Meter zu ersetzen, empfiehlt sich
nicht. Letzterer hat weder die
erforderliche Sensitivität noch einen
ausreichenden positiven Vorhersage-
wert.
Bei Patienten mit saisonal auftreten-
den Symptomen ist darauf zu achten,
dass der Test in der entsprechenden
Jahreszeit durchgeführt wird.
Um BIB-Episoden zu vermeiden,
sollte der Patient folgende Regeln be-
herzigen:
Vor jeder Trainingseinheit aufwär-
men, etwa mit kurzen Sprints oder
sechs Minuten steil bergan laufen.
Das Training sollte nicht in einer
Umgebung mit hoher Luftverschmut-
zung oder hoher Allergenbelastung er-
folgen.
Auch trockene Luft ist möglichst zu
vermeiden.
Für die medikamentöse Therapie
werden in erster Linie kurz wirksame
b
-Agonisten empfohlen, die nach Be-
darf eingesetzt werden. Die tägliche
Anwendung ist kontraproduktiv, da sie
zur Gewöhnung an das Präparat führt.
Damit kann dieses nicht mehr als Re-
scue-Medikament eingesetzt werden.
Eine bis zu viermal wöchentliche An-
wendung, jeweils vor dem Sport, ist je-
doch möglich.
Besteht noch häufiger Bedarf, kann
man Leukotrienantagonisten oder ein
inhalatives Kortikosteroid in Erwä-
gung ziehen. Letztere eignen sich
besonders für BIB-Patienten, die
gleichzeitig an Asthma leiden. Die Au-
toren um Smoliga weisen darauf hin,
dass es bis zu vier Wochen dauern
kann, bis ein inhalatives Kortikostero-
id sein Wirkungsmaximum erreicht.
Für den Fall, dass die Symptome
trotz aller genannten Maßnahmen an-
halten, raten die Experten:
Die Inhaler-Technik überprüfen.
Die Spirometrie wiederholen.
Führt beides nicht zum Ziel, sollte
man die Diagnose überdenken.
Klagt ein Patient nach dem
Sport über Atemnot, sollte
man eine belastungsindu-
zierte Bronchokonstriktion
erwägen. Die Abgrenzung
zum Asthma oder zur
laryngealen Obstruktion ist
schwierig. US-Ärzte zeigen,
worauf es dabei ankommt.
Bronchokonstriktion durch
Belastung: Tipps zur Diagnostik
Von Elke Oberhofer
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Belastungsinduzierte
Bronchokonstriktion
Symptome
entwickeln sich
binnen 15 Minuten nach der
Anstrengung und klingen
binnen einer Stunde wieder ab.
Es folgt oft eine refraktäre
Phase
von ein bis drei Stunden:
In dieser Zeit kann es zu weniger
ausgeprägten Symptomen
kommen, wenn der Patient sich
erneut belastet.
Symptome
könne aber auch
während des Sports auftreten.
Belastungsinduzierte Bronchokonstriktion: Ein Belastungstest in Verbindung mit einer
Spirometrie sichern die Diagnose.
© MATHIAS ERNERT, UNIKLINIKUM HEIDELBERG