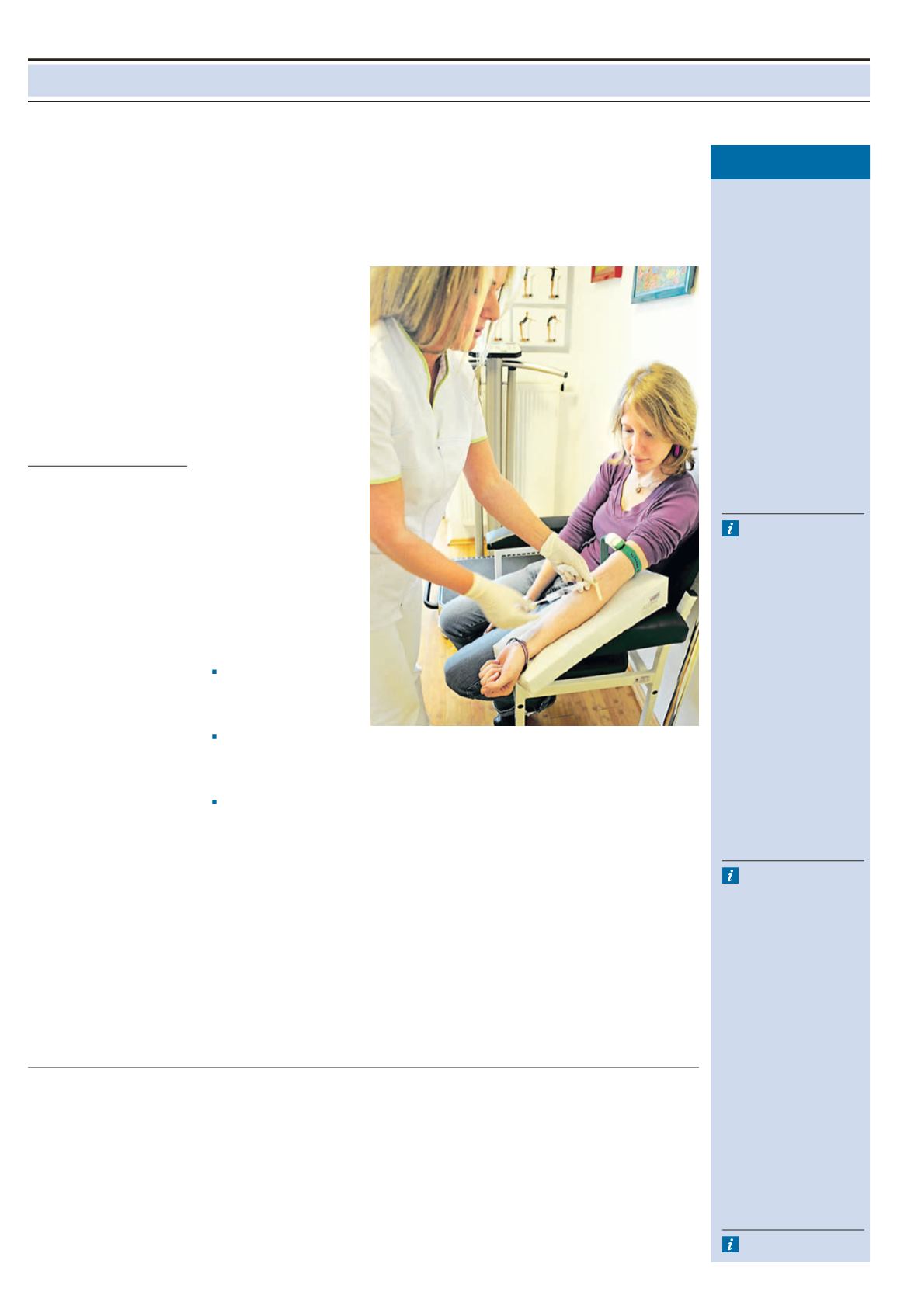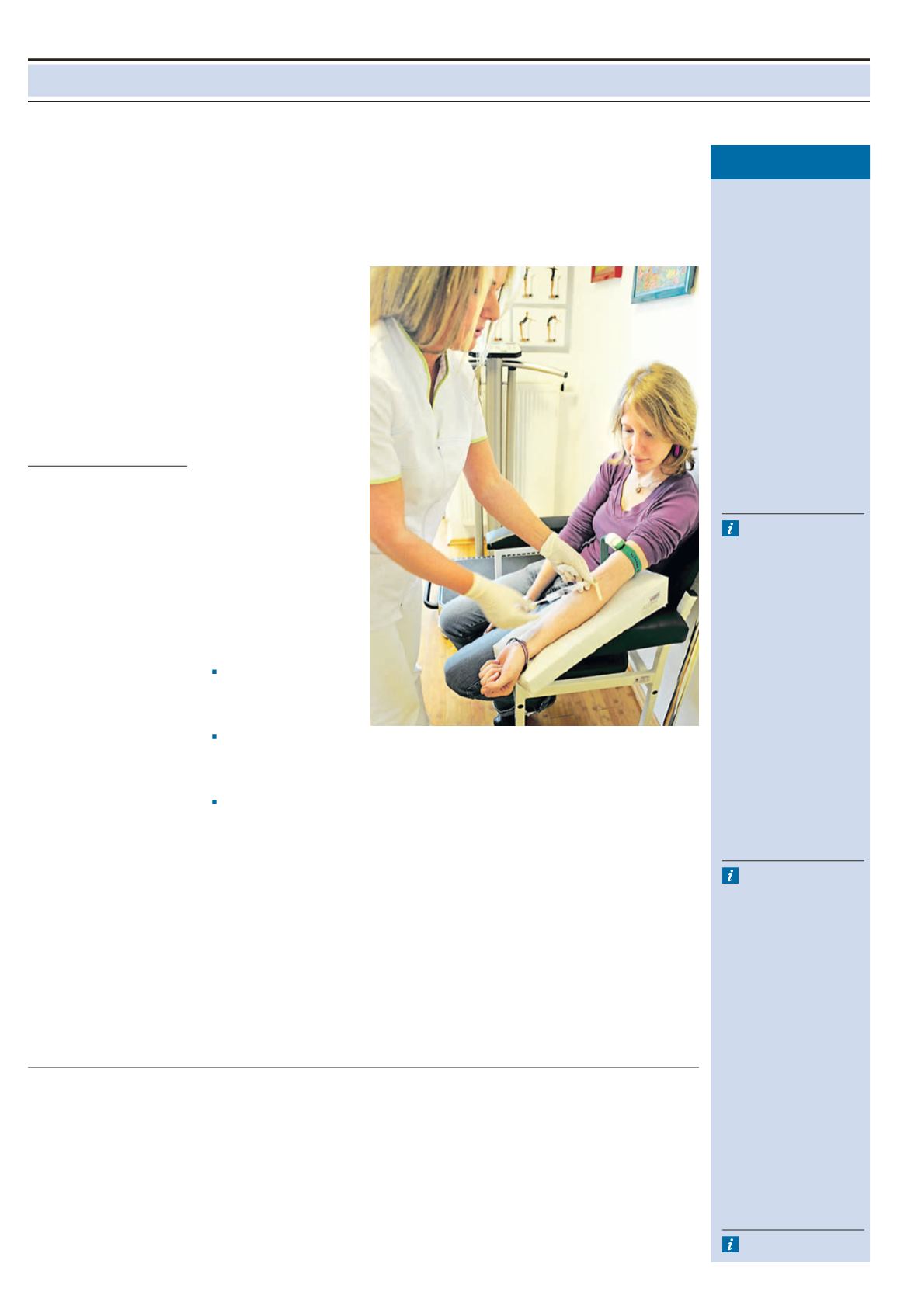
Medizin
BDI aktuell
April 2016
11
Im Rahmen der Zika-Virus-Epidemie
in Süd- und Mittelamerika sind mitt-
lerweile auch in Deutschland infizierte
Personen aufgetaucht. Experten des
Bernhard-Nocht-Instituts für Tropen-
medizin (BNITM) warnen, dass viele
Infektionen aufgrund der unspezifi-
schen Symptomatik nicht erkannt
würden. Für Ärzte hat das BNITM
Empfehlungen für die Diagnostik ins
Internet gestellt
).
Symptome, die auf das Zika-Fieber
hindeuten, sind demnach Fieber,
Kopfschmerzen,
Abgeschlagenheit,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Haut-
ausschlag sowie eine nichteitrige Bin-
dehautentzündung. Damit ähnelt das
Krankheitsbild einem grippalen Infekt,
aber auch anderen mückenübertrage-
nen Infektionen wie dem Dengue-Fie-
ber. Die Infektion, so heißt es in der
Mitteilung, könne aber auch nur mit
wenigen der genannten Symptome
oder gänzlich symptomfrei verlaufen.
In den meisten Fällen sei von einer
Krankheitsdauer von drei bis sieben
Tagen und einer Spontanheilung aus-
zugehen.
Aufmerksam werden sollte man als
Arzt vor allem bei erkrankten Rück-
kehrern aus tropischen Regionen Süd-
und Mittelamerikas, aber auch aus der
Karibik; diese gelten derzeit als Ende-
miegebiete. Die Experten weisen je-
doch darauf hin, dass sich diese Vertei-
lung rasch ändern könne. Informatio-
nen zu aktuellen Entwicklungen sowie
eine Karte der Transmissionsgebiete
finden sich zum Beispiel bei der WHO
im Internet
).
Vorrangig wird empfohlen, bei je-
dem Rückkehrer aus einem tropischen
Gebiet, der mit entsprechenden Symp-
tomen in die Arztpraxis kommt, Mala-
ria auszuschließen.
PCR oder Serologie?
Eine Laboruntersuchung auf eine
Zika-Virus-Infektion ist laut BNITM
bei allen Reiserückkehrern aus Epide-
mie- und Endemiegebieten sinnvoll,
die innerhalb von drei Wochen die
typischen Symptome entwickeln. Da-
bei ist die vergangene Zeit seit Symp-
tombeginn für das Vorgehen entschei-
dend (siehe Kasten). Besondere Auf-
merksamkeit gilt schwangeren Reise-
rückkehrerinnen: Bei diesen ist eine
serologische Untersuchung mit IgM-
und IgG-Nachweis auch dann sinn-
voll, wenn sie nicht erkrankt sind. Das
Gleiche gilt für männliche Rückkehrer
mit schwangerer Partnerin. Bei allen
anderen Reisenden rät das BNITM
von einer Testung auf eine Zika-Vi-
rus-Infektion ab. Ein diagnostischer
Algorithmus hierzu findet sich eben-
falls unter
.
Die US-Gesundheitsbehörde CDC
(Centers for Disease Control and Pre-
vention) weist darauf hin, dass die
Interpretation eines positiven Antikör-
pertests bei asymptomatischen Perso-
nen schwierig sei (MMWR 2016; 65:
122). Es bestehe eine Kreuzreaktivität
mit anderen Flaviviren wie dem Den-
gue-Virus, dem West-Nil-Virus und
dem Gelbfiebervirus. Auch eine voran-
gegangene Gelbfieberimpfung kann
demnach zu einem positiven Resultat
führen.
Meldepflicht gibt es noch nicht
Nach Informationen der Gesellschaft
für Virologie (GfV) ist ein Neutralisa-
tionstest (NT) geeignet, ein positives
Ergebnis für den Nachweis von Zika-
Virus-Antikörpern zu bestätigen. Da-
bei müsse das NT-Ergebnis für Zika-
Virus um mindestens vier Titerstufen
über demjenigen liegen, das für einen
vergleichend
durchzuführenden
Dengue-Virus-NT erhalten wird. Das
BNITM rät im Falle eines positiven
Testergebnisses bei Schwangeren mit
dem behandelnden Frauenarzt Kon-
takt aufzunehmen. Eine Meldepflicht
besteht derzeit nicht.
Betroffene werden symptomatisch
behandelt mit schmerz- und fiebersen-
kenden Medikamenten, viel Ruhe und
ausreichend Flüssigkeit. Für Ärzte gibt
es weiterführende Informationen und
Beratung
im
Internet
).
Zika-Verdacht nach einer Reise:
Das raten Experten
Zika-Virus-Infektionen gibt
es mittlerweile auch bei
Reiserückkehrern in
Deutschland. Angesichts
der unspezifischen Sympto-
me stellt sich die Frage,
wen man einem Labortest
unterziehen soll. Empfeh-
lungen hierzu geben Ärzte
des Hamburger Instituts für
Tropenmedizin.
Von Elke Oberhofer
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zika-Diagnostik
Bei Reiserückkehrern
aus Epide-
miegebieten mit Symptomen rät das
Bernhard-Nocht-Institut zu einer
Abklärung. Entscheidend für das
Vorgehen ist die Zeit seit Symptom-
beginn.
Bis zum 7. Tag nach Symptom-
beginn
ist die PCR aus Serum
oder Plasma und zusätzlich Urin
zum direkten Nachweis von
Virus-RNA sinnvoll.
Vom 8. bis 27. Tag
wird die
Serologie aus einer Serumprobe
zum Nachweis von IgM- und
IgG-Antikörpern empfohlen, zu-
sätzlich eine PCR nur aus Urin.
Mehr als 28 Tage nach Symp-
tombeginn
raten die Experten
nur noch zu einer Serologie aus
einer Serumprobe.
Serum oder Plasma ist für die PCR zur Zika-Diagnostik nötig.
© KLAUS ROSE
Lesetipp
Nach Angaben der AOK werden in
Deutschland in 1031 Kliniken
Patienten mit kolorektalen Karzino-
men operativ versorgt. Ende 2014
waren davon 257 als Darmkrebs-
zentrum der Deutschen Krebsgesell-
schaft zertifiziert, in denen 23842
Patienten mit einem neu diagnosti-
zierten kolorektalen Karzinom be-
handelt wurden. Bei einer geschätz-
ten Inzidenz von 63900 entspricht
dies einem Versorgungsgrad von
37,3 Prozent. Allerdings liegt nach
Auskunft der Deutschen Krebs-
gesellschaft dieser Anteil für das
Rektumkarzinom mit ca. 85 Prozent
deutlich höher. Ob diese Zentren-
bildung zu einer Verbesserung der
Versorgung führt, ist seit Beginn
der Zertifizierung Gegenstand
intensiver Diskussion.
ZDer Onkologe 2016;
22: 167– 176
Die erhöhte Inzidenz bestimmter
Tumorarten im Rahmen chronischer
Entzündungen und Infektionen
einerseits und das erhöhte Tumor-
risiko unter Immunsuppression an-
dererseits verdeutlichen die vielsei-
tige und komplexe Beeinflussung
der Tumorpathogenese durch das
Immunsystem. Daher ist gut vor-
stellbar, dass immunmodulatorische
Therapien neben der Grunderkran-
kung auch das Malignomrisiko
beeinflussen. Arbeiten aus der
Grundlagenforschung identifizierten
verschiedene immunologische
Signalwege, die für die Tumor-
entstehung bzw. Tumorabwehr
relevant sind. Diese Übersichts-
arbeit stellt aktuelles Wissen über
Effekte des Immunsystems auf die
Krebsentstehung dar und versucht,
soweit dies möglich ist, das Krebs-
risiko unter den vorhandenen Thera-
pieoptionen zu konkretisieren.
Zeitschrift für Rheumatologie 2016,
75: 13-21
Verbessert die Zentren-
bildung die klinische
Versorgungsqualität?
Einfluss der Therapie
auf das Krebsrisiko bei
rheumatoider Arthritis
Welche Medikamente
sind bei der Reanimation
sinnvoll? Welche nicht?
Vor dem Hintergrund eines bislang
nicht eindeutig erbrachten
Wirksamkeitsnachweises hat
die Ambivalenz, mit der die Fach-
welt der Gabe von Medikamenten
bei der Wiederbelebung gegenüber-
steht, auch in den Leitlinien zuge-
nommen. Verantwortlich hierfür ist
eine sehr heterogene Datenlage, die
im Wesentlichen auf den Ergebnis-
sen von Beobachtungsstudien und
kleinen kontrollierten Studien
beruht. Von den Ergebnissen zweier
derzeit laufender großer randomi-
sierter und kontrollierter Studien,
welche die Wirksamkeit von Adrena-
lin und von Amiodaron oder Lido-
cain gegenüber Placebo bei kardio-
pulmonaler Wiederbelebung unter-
suchen, darf mehr Klarheit hinsicht-
lich der sinnvollen Anwendung von
Medikamenten bei einem Kreislauf-
stillstand erhofft werden.
ZHerzschrittmachertherapie + Elekt-
rophysiologie 2016; 27:15–19
2002 wurde die Vorsorge-Koloskopie
in das gesetzliche Krebsfrüherken-
nungs-Programm in Deutschland auf-
genommen. Zwischen 2003 und 2012
sank die altersstandardisierte Darm-
krebs-Neuerkrankungsrate
in
Deutschland um rund 14 Prozent, wie
Forscher im Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) nun berech-
neten (Dtsch Arztebl Int 2016; 113:
101-6). Der Rückgang zeigte sich am
stärksten in den Altersgruppen ab 55
Jahren, in denen die Untersuchung an-
geboten wird, teilt das DKFZ mit. Die
altersstandardisierte
Darmkrebs-
Sterblichkeit sank demnach um fast 21
Prozent bei Männern und sogar um
über 26 Prozent bei Frauen. Zwischen
2003 und 2012 nahmen etwa 20 bis
30 Prozent der Anspruchsberechtigten
das Angebot der Darmkrebsfrüherken-
nung wahr.
Professor Hermann Brenner und
Kollegen im DKFZ haben gemeinsam
mit Wissenschaftlern vom Krebsregis-
ter Saarland und der Universität Lü-
beck untersucht, ob und in welchem
Umfang die Vorsorge-Koloskopie be-
reits zehn Jahre nach ihrer Einführung
Wirkung zeigt. Zwischen 2003 und
2012 sank die altersstandardisierte
Neuerkrankungsrate in Deutschland
um 13,8 Prozent bei Männern und
um 14,3 Prozent bei Frauen, so das
DKFZ.
Die
altersstandardisierte
Darmkrebs-Sterblichkeit sank um
20,8 Prozent bei Männern und sogar
um 26,5 Prozent bei Frauen. In den
Altersgruppen unter 55 Jahren sei kein
vergleichbarer Rückgang der Neuer-
krankungen zu beobachten.
(eb)
Seit Einführung der Vorsor-
ge-Koloskopie sinkt die Zahl
der Darmkrebs-Neuerkran-
kungen und -Todesfälle.
Prävention: Koloskopie zeigt Erfolge