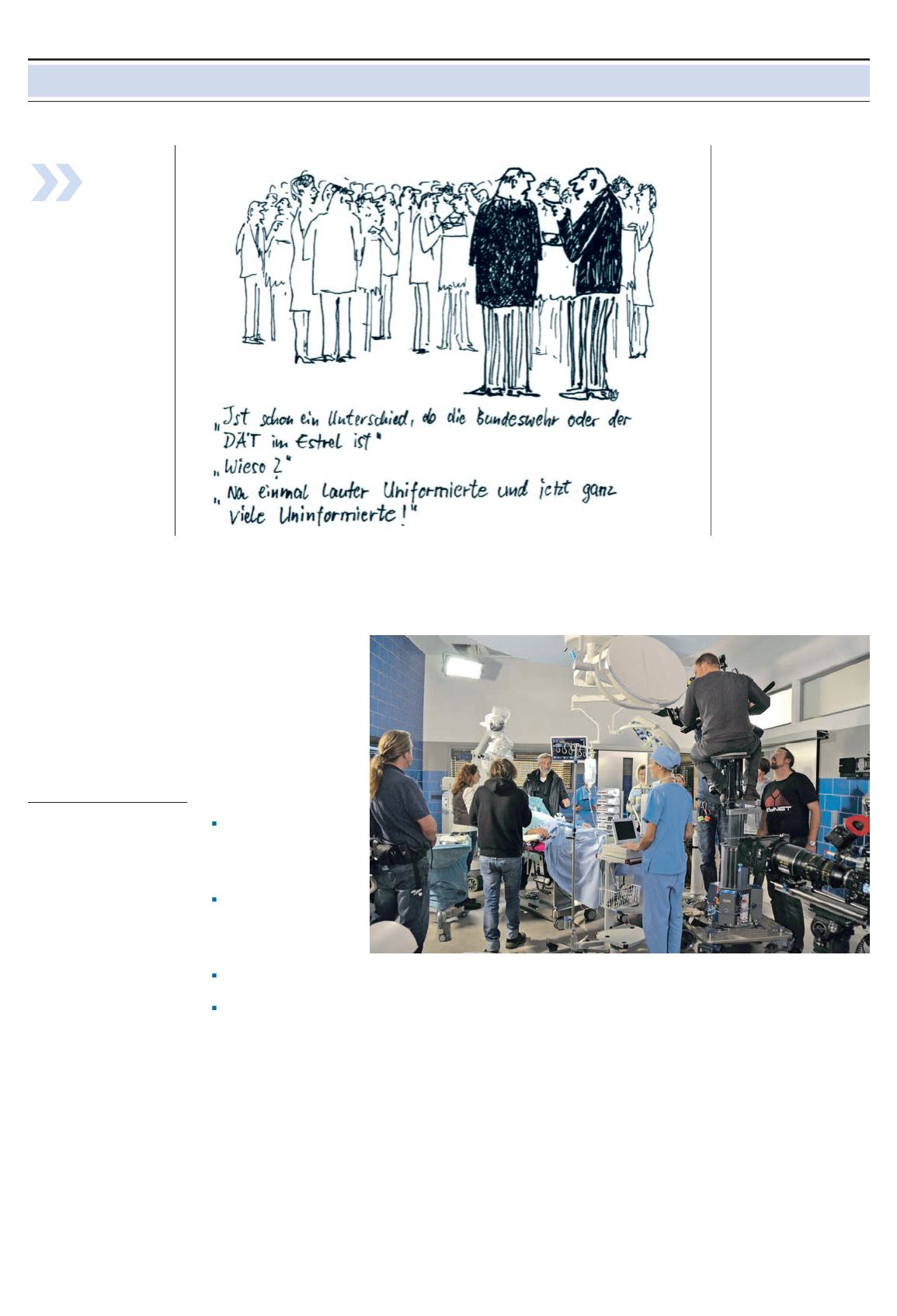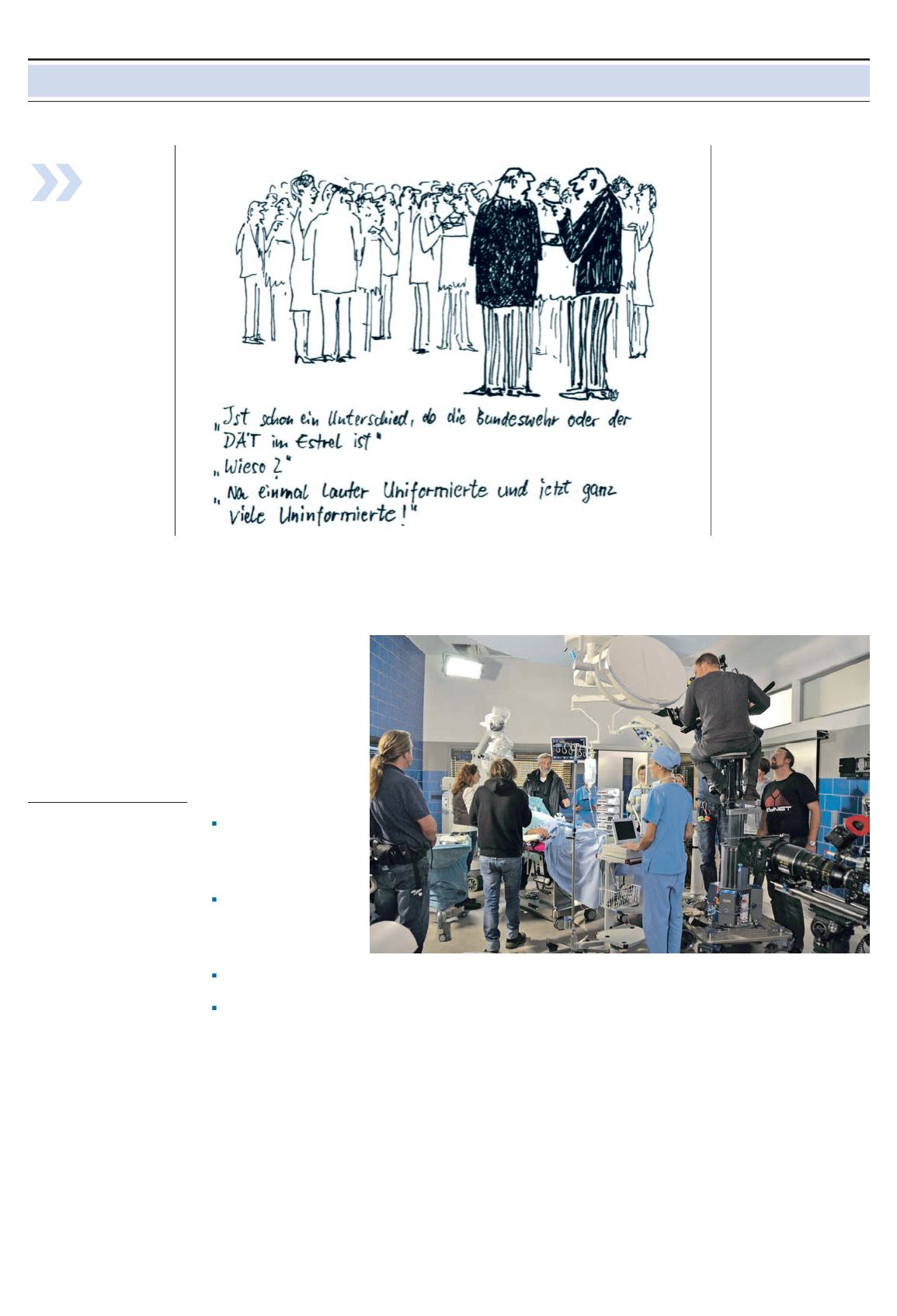
Jeden Dienstag um 21:00 Uhr sehen
etwa 6 Millionen Fernsehzuschauer ei-
ne Serie mit dem Titel „In aller
Freundschaft“. Dahinter verbergen
sich Geschichten um Ärzte, Kranken-
schwestern und Pfleger – und um ein
Krankenhaus, das sich Sachsenklinik
nennt. Berichtet wird dabei auch über
Patienten und ihre Krankheiten. Sehr
authentisch werden deren Freud und
Leid sowie die medizinischen Eingriffe
zur Diagnostik und Therapie ins Bild
gesetzt. Auch der Krankenhausalltag
mit den üblichen Reibereien zwischen
den dort handelnden Personen und
natürlich auch ihre Beziehungskisten
werden dargestellt. Die Ärzte spielen
dabei eine zentrale Rolle.
Die hohen Einschaltquoten spre-
chen dafür, dass der Fernsehzuschauer
glaubt und hofft, dass auch in der
Wirklichkeit die Ärzte vergleichbar le-
ben und handeln. Es lohnt sich des-
halb, sowohl die einzelnen abgebilde-
ten Charaktere als auch die Hand-
lungsabläufe unter diesem Gesichts-
punkt zu analysieren.
Konflikte wie im richtigen Klinikleben
Ärztlicher Direktor ist Dr. Roland
Heilmann, der Nachfolger von Profes-
sor Gernot Simoni, der als ausglei-
chender gütiger älterer Kollege nur
noch vereinzelt auftaucht. Dr. Heil-
mann hat immer ein Ohr für die Nöte
seiner Kolleginnen und Kollegen und
für das übrige Personal. Konflikte gibt
es wie im richtigen Krankenhausleben
mit der Verwaltungsleitung, vertreten
durch Sarah Marquardt, die das Kran-
kenhaus unter rein ökonomischen As-
pekten führt und dabei auch vor
Tricksereien nicht zurückschreckt. Sie
ist die Gegenspielerin von Dr. Heil-
mann, der sich im Fernsehen meist
deshalb durchsetzt, weil er allein das
Wohl des Patienten im Blick hat.
In der Sachsenklinik gibt es zahlrei-
che Ärztinnen in Führungsposition.
Etwa Dr. Kathrin Globisch, sehr zuge-
wandt, aber auch ein bisschen streng
und Lea Peters, eine Hirnchirurgin.
Nicht vergessen darf man den ehrgei-
zigen und manchmal aufbrausenden
Dr. Philipp Brentano, der mit der
Oberschwester Arzu Ritter verheiratet
ist, die wiederum zwei Kinder unter-
schiedlicher Väter versorgt. Man sieht,
es geht menschlich zu. Die Ärzte sind
keine Halbgötter. Eine besondere Rol-
le spielt Dr. Rolf Kaminski, der Urolo-
ge und Belegarzt. Er ist distanziert,
leicht sarkastisch, zeigt aber dennoch
einen hohen Einsatz beim Patienten.
Die Geschichten laufen nach einem
bestimmten Schema ab. In der Regel
kommt ein Patient nach einem Unfall
oder mit einer unklaren Erkrankung.
Einer der Ärzte übernimmt ihn und
bleibt auf Dauer für ihn zuständig. Am
Ende geht natürlich alles gut aus.
Ärzte mit Ecken und Kanten
Die TV-Aufnahmen werden übrigens
von medizinischen Experten mitbe-
treut und die Eingriffe sehen deshalb
sehr lebensnah aus. Das hier vermittel-
te Arztbild kommt offensichtlich beim
Zuschauer gut an. Die Ärzte haben
menschliche Schwächen und unter-
schiedliche Charaktere. Sie sind aber
immer perfekt und einsatzbereit, wenn
es um die Patienten geht. Es fehlt auch
nicht an einem Schuss Selbstkritik.
Untereinander pflegt man eine flache
Hierarchie. Den autoritären Chefarzt
gibt es nicht. Jeder Einzelne ist für die
Betreuung seiner Patienten verant-
wortlich. Der ärztliche Direktor ist
mehr für den Organisationsablauf zu-
ständig und trotzt dabei den Ansprü-
chen der Verwaltung. Er verteidigt die
Interessen der Patienten gegenüber
den ökonomischen Vorgaben im Ge-
sundheitswesen.
Dieses Fernsehbild ist natürlich
idealisiert und hat im Vergleich zur
Wirklichkeit einige Lücken. So fehlen
die Ärzte in Weiterbildung, die sonst
das Heer der im Krankenhaus arbei-
tenden Ärzteschaft ausmachen. Die
Serie will offensichtlich vermeiden,
manche ärztliche Unsicherheit bei der
Entscheidung in diesem Sektor darzu-
stellen. Auch Triagesituationen sieht
man selten, der Patient steht immer im
Mittelpunkt. Übrigens: Privatpatienten
gibt es nicht.
Bei aller Kritik an der idealisierten
Darstellung dieser jüngeren Ärztege-
neration, mindestens einen dieser Ärz-
te wird sich der Zuschauer immer als
seinen Doktor vorstellen können. Die
Serie ist damit schon ein bisschen
„Reklame“ für den schönen Beruf des
Arztes und Werbung für unseren Be-
rufsstand.
Auch lange nach der
Schwarzwaldklinik sind
Arztserien noch immer
beliebt. Bestes Beispiel ist
„In aller Freundschaft“.
Seit 1998 läuft die Serie –
und wirbt dabei ganz
nebenbei für den schönen
Beruf des Arztes.
Die gespielte Welt der Klinikärzte
Die Kamera läuft für die nächste Szene im OP. Die Klinikräume sind detailgetreu eingerichtet.
© JENS HAENTZSCHEL
Von Dr. Hans-Friedrich Spies
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Die Fakten zur Serie
Die Arztserie
„In aller Freund-
schaft“ wird seit Juni 1998
gedreht und ist bei mittlerweile
über 700 Folgen angelangt. Ort
des Geschehens ist die fiktive
Sachsenklinik in Leipzig.
Drehort
ist jedoch keine Klinik,
sondern seit September 2001
sind es die Studios der media
city Leipzig. Vorher wurden die
Folgen auf dem Alten Messe-
gelände in Leipzig gedreht.
Die Serie läuft
immer Dienstag-
abend um 21:00 Uhr auf ARD.
Seit einem Jahr
gibt es zusätz-
lich mit der Vorabendserie
„In aller Freundschaft – Die
jungen Ärzte“ einen jungen
Ableger der Erfolgsserie,
Sendezeit ist Donnerstagabend
18:50 Uhr.
16
April 2016
BDI aktuell
Panorama
ZITIERT
Die Politik macht
Druck und das
zu Recht: Natürlich
brauchen wir eine
größere Durchlässig-
keit an den Sektoren-
grenzen. Aber das
kann nur sinnvoll
sein, wenn es mit
fairen Wettbewerbs-
bedingungen einher-
geht.
Dr. Andreas Gassen
,
Vorstandsvorsitzender der KBV, in seiner
Rede an die KBV-Vertreterversammlung
am 4. März 2016
AUFGEGRIFFEN
© PROF. DR. MED HARALD MAU
Mit einem falschen Tastendruck hat
die AOK einen Rentner in Sprock-
hövel (Nordrhein-Westfalen) für tot
erklärt. Die Folgen: Nachdem die
Krankenversicherung automatisch
die Rentenversicherung und die
Stadtverwaltung benachrichtigt hat-
te, erhielt die vermeintliche Witwe
ein Beileidsschreiben der Stadt und
der Rentner keine Rente samt Auf-
stockungsgeld mehr. „Es war ein
menschliches Versehen eines Mitar-
beiters“, sagte AOK-Sprecher Jens
Kuschel. „Er hat einfach die falsche
Taste gedrückt. Wir haben alles so-
fort rückabgewickelt.“ Für das
quicklebendige Paar gab es auch
noch Blumen.
Ähnliches war im Januar in ei-
nem Krefelder Klinikum passiert:
Eine Ärztin rief mitten in der
Nacht die Tochter einer Krebspa-
tientin an und unterrichtete sie
über den Tod ihrer Mutter. Doch
die Mutter lebte noch. Grund für
die falsche Todesnachricht war eine
Verwechslung.
(dpa)
Rentner
irrtümlich für
tot erklärt
AUCH DAS NOCH