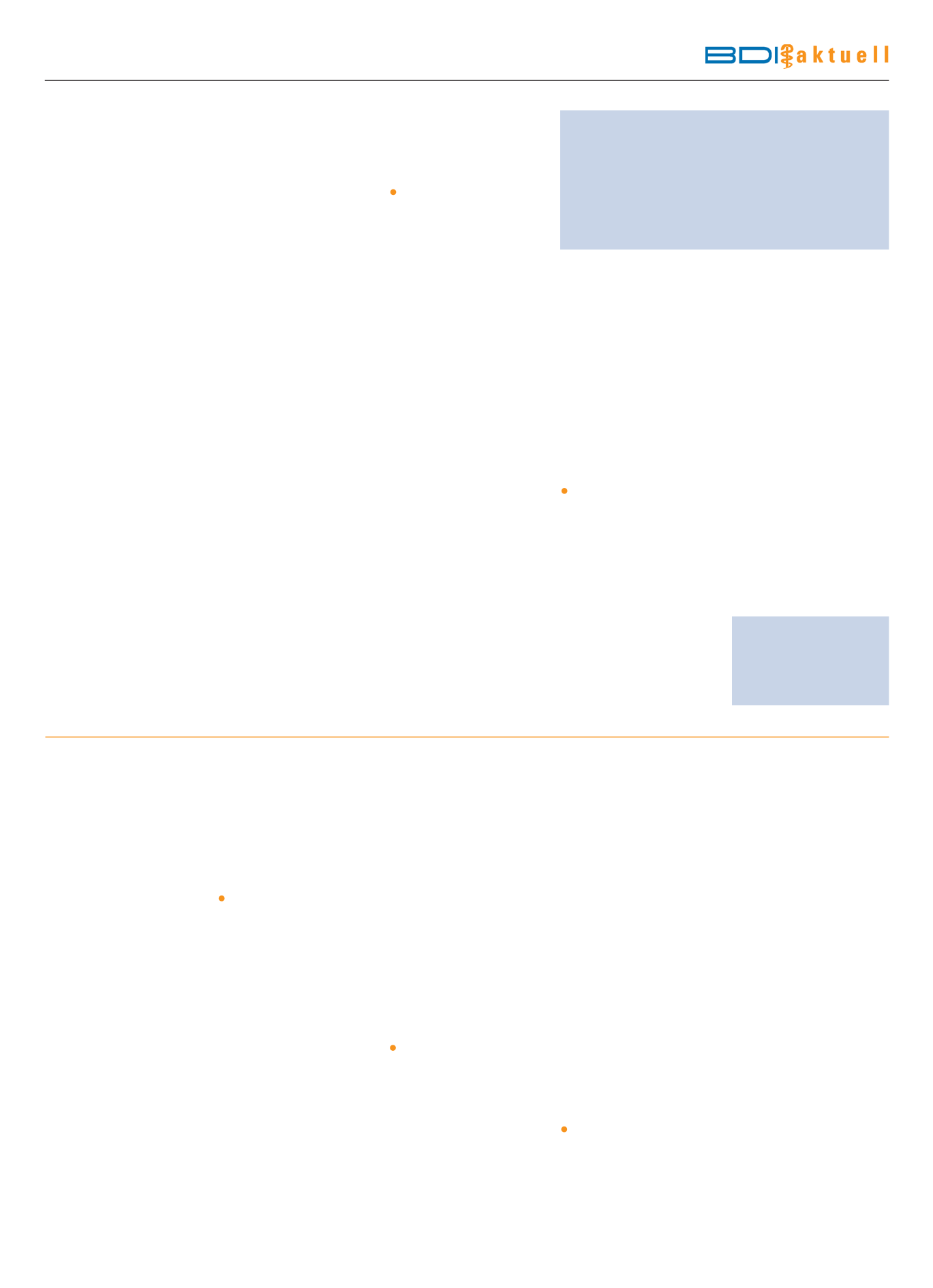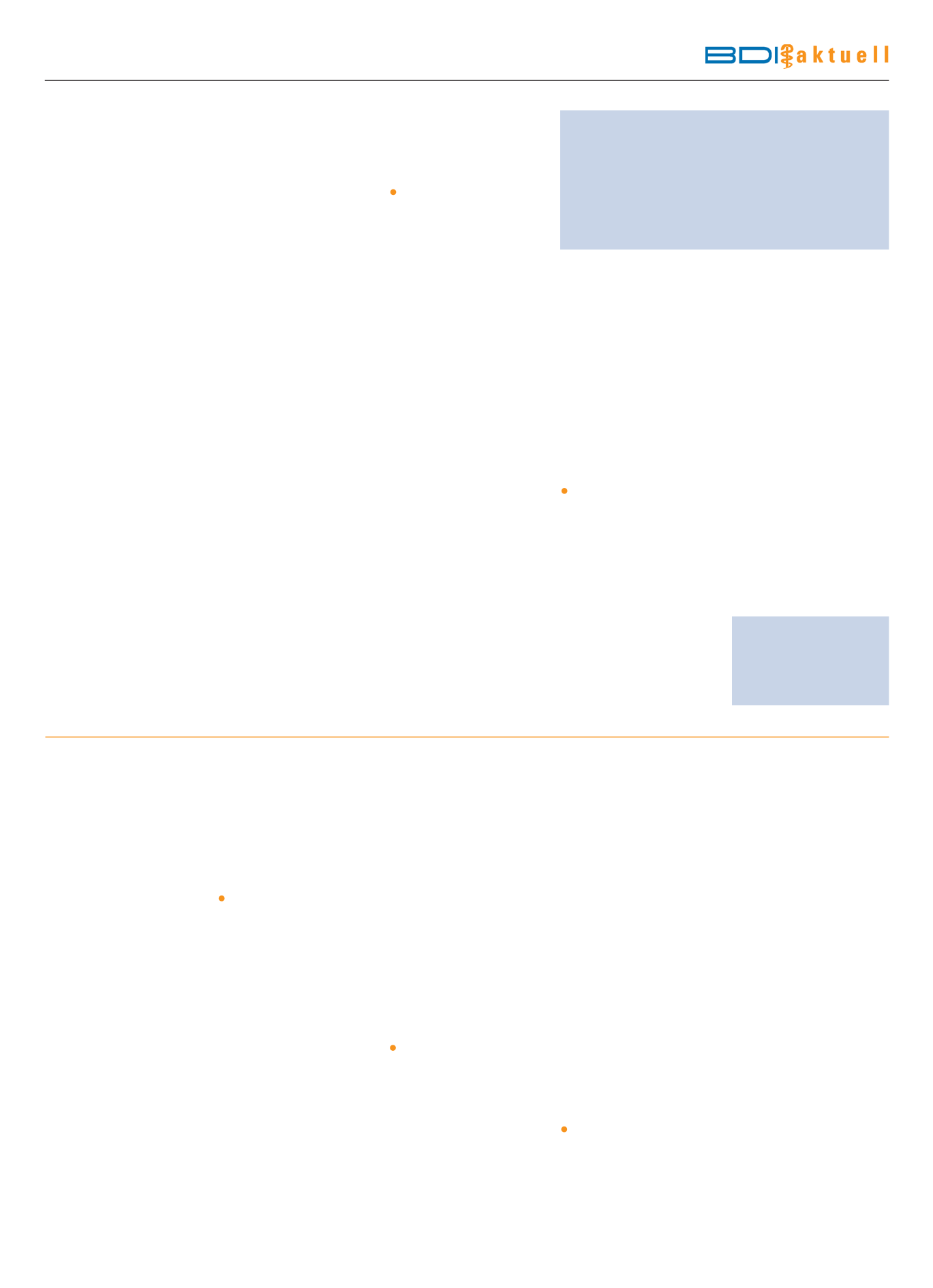
Nr. 4 • April 2014
6
Berufspolitik
Wie schon in früheren Publikationen
fordert er die Politik dazu auf, die
Anpassung des Leistungskatalogs der
gesetzlichen Krankenversicherung an
die begrenzten Mittel endlich anzuge-
hen. Es müsse exakt definiert werden,
was mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln geleistet werden kann und was
nicht. Dabei dürfe es kein Tabu geben,
keine Ausnahme von der Entschei-
dung, wo und wie begrenzte Mittel
eingesetzt werden sollen. Solange sich
die Politik dieser Aufgabe entziehe,
werde Leistungserbringern, und hier
insbesondere Ärzten, die Aufgabe
zufallen zu entscheiden, was im Ein-
zelfall gewährt und was verweigert
werden muss.
Nur mit festen Preisen ist nach Beskes
Auffassung eine leistungsgerechte
Honorierung möglich. Jede Form von
Budgetierung schließe eine leistungs-
gerechte Honorierung aus. Andernfalls
werde sowohl das Morbiditätsrisiko als
auch das Risiko einer Unterfinanzie-
rung der GKV insbesondere auf die
Ärzte übertragen.
Versorgungsumfang und Versorgungs-
qualität werden entscheidend von Zahl
und Qualifikation der Gesundheitsbe-
rufe bestimmt. Für Beske steht fest,
dass schon allein die sich bis 2060 ver-
ringernde Zahl von Personen im
erwerbsfähigen Alter um 17 Millionen
und die abnehmende Zahl der nach-
wachsenden Generation um 5 Millio-
nen zu Arbeitskräftemangel insgesamt
und zu einem Fachkräftemangel in
Gesundheit und Pflege führen wird.
Alle Berufe stehen in der Gewinnung
von Arbeitskräften in Konkurrenz
zueinander. So, wie der Gesamtbedarf
nicht gedeckt werden kann, wird auch
der Bedarf in Gesundheit und Pflege
nicht gedeckt werden können. Schon
jetzt häufen sich Berichte über den
Mangel an Pflegekräften und Ärzten
mit Hinweis auf eine sich verschärfen-
de Situation. PricewaterhouseCoopers
hat errechnet, dass 2030 von 165 000
fehlenden Ärzten, 400 000 fehlenden
Pflegekräften und 950 000 fehlenden
Fachkräften im Gesundheitswesen ins-
gesamt ausgegangen werden kann.
Vier Einflussfaktoren
Anders als bei Gesundheit und Pflege
gibt es für eine Prognose von Versor-
gungsstrukturen kaum belastbare Zah-
len, stellt Beske fest. Er macht jedoch
vier Einflussfaktoren aus:
▶ Arztberuf: Der Anteil von Ärztinnen
steigt. Bei Ärztinnen, aber auch bei
Ärzten, besteht zunehmend der
Wunsch nach Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Freizeit. Insbe-
sondere bei Ärztinnen nimmt Teil-
zeitbeschäftigung zu. Auch in der
ambulanten Versorgung steigt der
Wunsch nach einem Angestellten-
verhältnis.
▶ Bedarf an Ärzten: Die Wahrschein-
lichkeit spricht dafür, dass der Man-
gel an Ärzten, besonders an Haus-
ärzten, weiter zunimmt. Eine Lösung
wird in einem verstärkten Einsatz
ausländischer Ärzte zu sehen. Beske
begrüßt es, dass ausländische Ärzte
in Deutschland arbeiten wollen und
so zur Sicherstellung der ärztlichen
Versorgung beitragen. Er erhebt aber
Bedenken gegen unzureichende
Sprachkenntnisse dieser Ärzte.
▶ Spezialisierung in der Medizin: Spe-
zialisierung bedeutet höhere Qualifi-
kation und führt bei vielen Indika-
tionen zu einer verbesserten Versor-
gung. Es steigt die Notwendigkeit
zur Kooperation. Gleichzeitig erwei-
tert sich das Einzugsgebiet, was für
die Patienten weitere Wege bedeu-
tet. Der Anteil chronisch kranker,
multimorbider und schwerkranker
Patienten nimmt zu. Dies erfordert
z.B. im Krankenhaus Kooperation
mehrerer Disziplinen unter einem
Dach. Die Versorgungsqualität steigt,
allerdings mit höheren Kosten und
mit weiteren Wegen für den Patien-
ten.
▶ Ausdünnung ländlicher Räume:
Gründe sind die Abnahme der
Bevölkerung insgesamt und eine
Wanderungsbewegung von ländli-
chen in städtische Räume.
Diese Einflussfaktoren haben ihre
Eigendynamik, stellt Beske fest. Sie
werden Veränderungen erzwingen.
Ambulant vor stationär
Der Kieler Gesundheitsexperte spricht
sich deutlich für das Motto „ambulant
vor stationär“ aus. Die Zahl der im
Krankenhaus stationär behandelten
Patienten ließe sich so reduzieren, mit
einem damit verbundenen geringeren
Bedarf an Krankenhausbetten. Er plä-
diert auch für die derzeit ungeliebte
elektronische Gesundheitskarte. Es
liege im Interesse von Patient, Arzt
und Gesundheitssystem, argumentiert
Beske, dass zeitgemäße Informations-
und Kommunikationssysteme wie
elektronische Gesundheitskarte, elek-
tronische Gesundheitsakte und Tele-
medizin eingesetzt werden. Der Man-
gel an Geld und an Fachpersonal werde
den Ausbau dieser Systeme beschleu-
nigen.
Die Zukunft, sagt der Versorgungsfor-
scher, gehöre der Kooperation auf frei-
williger Basis, sowohl innerärztlich als
auch berufs- und sektorenübergrei-
fend, von der ambulanten und statio-
nären Versorgung bis hin zur Rehabili-
tation und Pflege, örtlich und regional
gestaltet. Er plädiert für ein geändertes
SGB V, das neue Versorgungstrukturen
nicht nur ermöglicht, sondern fördert.
Auf lange Sicht gibt es für Beske nur
zwei denkbare Grundformen von Ver-
sorgungssystemen: ein System mit Ele-
menten der sozialen Marktwirtschaft
oder eine immer weitergehende Regle-
mentierung, an deren Ende ein staatli-
ches Gesundheitssystem steht. „Die
Politik entscheidet, welcher Weg
gegangen wird.“
KS
„Die große Koalition
ignoriert den demografischen
Wandel“
Fritz Beske über die Gesundheitsversorgung von morgen
Der BDI hat die ambulante spezialfach-
ärztliche Versorgung von Anfang an
begrüßt, da die Forderungen der Ver-
tragsärzteschaft nach Bindung der
Leistung an Qualitätsvorgaben und
ohne Budgetierung weitgehend erfüllt
wurden. Zum anderen war es ein
Ansatz, um die medizinisch nicht mehr
zu rechtfertigende Grenze ambulant/
stationär aufzulockern. Gleichzeitig
hatte der BDI aber Befürchtungen, dass
die Umsetzung in den Selbstverwal-
tungsgremien die positiven Gedanken
des Gesetzgebers eher behindert als
befördert. Diese Befürchtungen schei-
nen wahr zu werden. Der Gemeinsame
Bundesausschuss als Gremium der
Selbstverwaltung wird von den soge-
nannten Bänken regiert. Diese werden
von der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung, von der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft und von den gesetzli-
chen Krankenkassen besetzt. Die
Patientenvertreter sind zwar anwe-
send, haben aber kein Stimmrecht.
Die KV hat die ASV behindert
Der Kassenärztlichen Vereinigung war
die ASV schon deshalb nicht ganz
geheuer, weil sie nicht als die zustän-
dige Abrechnungsbehörde anerkannt
wurde. Dies ergab sich zwangsläufig
aus dem Umstand, dass Vertragsärzte
und Krankenhäuser teilnehmen konn-
ten und Krankenhäuser sind nun mal
kein Mitglied in der Kassenärztlichen
Vereinigung. Für zahlreiche KV-Funk-
tionäre war dies Anlass, die Umset-
zung der ASV eher zu behindern, auch
wenn viele spezialisierte Fachärzte in
der gesetzlichen Vorgabe eine Chance
gesehen haben. Hier war die Interes-
senvertretung der Mitglieder im fach-
ärztlichen Bereich offensichtlich zweit-
rangig. Der Gesetzgeber hat leider als
Grundlage für die Vergütung den EBM
in der Anlaufphase vorgesehen, hat
aber darauf hingewiesen, dass in der
zweiten Stufe eigenständige Vergü-
tungsformen gefunden werden müs-
sen. Von Anfang an bestand eine
Schwierigkeit, den EBM als Leistungs-
verzeichnis im ambulanten Bereich
mit dem dort gültigen Erlaubnisvorbe-
halt auf die ASV mit dem Verbotsvor-
behalt und einem offenen Leistungs-
katalog zu übertragen. Es ist der Kas-
senärztlichen Vereinigung gelungen, in
den Vorgaben für die ASV nahezu
sämtliche EBM-Vorschriften auch bei
der Abrechnung durchzusetzen. So fin-
det sich die Systematik von lebenslan-
gen Arztnummern und der quasi
Abrechnung des einzelnen Vertrags-
arztes, auch wenn er in Gemein-
schaftsstrukturen abrechnet, auch in
der ASV wieder. Damit ist allen restrik-
tiven Maßnahmen bei der Abrech-
nung, wie wir sie aus der Kassenärztli-
chen Vereinigung kennen, wieder Tür
und Tor geöffnet.
Krankenkassen möchten Morbidi-
tätsrisiko nicht übernehmen
Die Krankenkassen waren mit der ASV
von Anfang an deshalb unglücklich,
weil sie eine Mengenentwicklung
befürchteten. Die Einschränkung im
Vergleich zum alten 116 b auf schwere
Verlaufsformen kam ihnen zupass,
weil sie mit einer geringeren Abrech-
nungsfrequenz rechnen mussten. Ihr
Sinnen und Trachten richtet sich
danach, das Morbiditätsrisiko dieses
von ihnen sogenannten neuen Sektors
nicht zu übernehmen. Der vom
Gesetzgeber geprägte Begriff, wer
kann, der darf, wurde von den Ver-
tragsärzten so interpretiert, dass hier
endlich die Krankenkassen für eine
qualitativ gesicherte Leistung auch das
Morbiditätsrisiko zu übernehmen hät-
ten. Es ist zu befürchten, dass die
Krankenkasse eine einmalige Bereini-
gung und damit die Übernahme des
Morbiditätsrisikos verweigern und die
Risiken der Mengenentwicklung wie-
der bei den Vertragsärzten selbst ablie-
fern wollen. Besonders prekär ist die
Vorgabe des Gesetzgebers, dass hier-
von Hausärzte und Fachärzte der
Grundversorgung – was man darunter
auch immer versteht – nicht betroffen
sein dürfen. Gelingt es den Kranken-
kassen, mit der Bereinigung die Über-
nahme des Morbiditätsrisikos zu
unterlaufen, holt man sich das Geld bei
den Ärzten, die es bei der ASV ausge-
löst haben. Für die spezialisierten Ver-
tragsärzte würde dies im Prinzip
bedeuten: Linke Tasche, rechte Tasche!
So weit darf es nicht kommen.
Wer beteiligt sich an der ASV?
In der Öffentlichkeit entsteht der Ein-
druck, dass man durch die Verabschie-
dung der Vorgaben im Gemeinsamen
Bundesausschuss bereits einen ent-
scheidenden Schritt getan hat und es
nicht mehr lange dauert, bis diese Vor-
gaben auch umgesetzt werden. Der
Gesetzgeber hat für den Ergänzten
Bewertungsausschuss, der für die
Honorarverhandlungen in der ASV
zuständig ist, eine Frist von sechs
Monaten gesetzt. Daran anschließend
kommt noch die beschriebene Proble-
matik der Bereinigung, die zwischen
den Kassen und der Kassenärztlichen
Vereinigung vereinbart werden muss.
Es wird also noch ein bisschen dauern,
bis die Beschlüsse des G-BA tatsächlich
in der Versorgung zum Tragen kom-
men.
Es bleibt noch die große Frage, ob
unter solchem Umständen die Beteilig-
ten, sprich die spezialisierten Vertrags-
ärzte und auch die Krankenhäuser,
überhaupt bereit sind, sich an der ASV
zu beteiligen. Dies ist nämlich freiwil-
lig.
Man sieht, dass der ursprünglich gute
Gedanke des Gesetzgebers durch die
Selbstverwaltung eher konterkariert
wird. Dennoch ist der Gesetzgeber
nicht ganz unschuldig an den Schwie-
rigkeiten, da einige Vorgaben, insbe-
sondere die Einführung des EBM als
Vergütungsgrundlage, falsch war. Um
die ASV in ihrem positiven Grundge-
danken zu retten, sollte der Gesetzge-
ber schleunigst eine Korrektur an den
entscheidenden Stellen vornehmen. Es
gibt ja Omnibusgesetze.
HFS
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
Was bleibt von der ASV übrig?
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat bei der Umsetzung der ambu-
lanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) die ersten Krankheits-
bilder in der Beratung abgeschlossen. Es handelt sich bei den selte-
nen Erkrankungen um die Tuberkulose und bei den Krankheitsbil-
dern mit besonderen Verläufen um die gynäkologischen Tumore .
Der große alte Mann der Versorgungsforschung in Deutschland, der
Gründer des Instituts für Gesundheits-System-Forschung (IGSF) in
Kiel, Prof. Fritz Beske, hat soeben sein neues Buch über die Gesund-
heitsversorgung von morgen vorgelegt. Darin erhebt der 91-jährige
Arzt und Gesundheitspolitikberater gravierende Vorwürfe gegen die
Politik, die sich zukunftsorientierten Weichenstellungen im Gesund-
heitswesen verweigere. Die große Koalition in Berlin ignoriere den
demografischen Wandel.
Beske, F.: Gesundheitsversorgung von
morgen. Was kommt auf Versicherun-
gen, was auf Ärzte und was auf Patien-
ten zu? Wissenschaftliche Verlagsge-
sellschaft, Stuttgart 2014
132 Seiten, 29,80 Euro.
Fritz-Beske-Institut
Der damalige Staatssekretär im Kieler Sozialministerium, Fritz Beske, gründete
1975 das Institut für Gesundheits-System-Forschung Kiel (IGSF), eine der ersten
deutschen Einrichtungen der Versorgungsforschung. Er hat es seitdem, 37 Jahre
lang, geleitet. Seit 2000 trägt das Institut Beskes Namen. Von 1984 bis 2004 war es
Kollaborationszentrum der Weltgesundheitsorganisation. 125 Bände in der instituts-
eigenen Schriftenreihe sind seither erschienen, zuletzt die „Versorgungsprognose
2060“. Da weder ein Nachfolger für Beske noch ein neuer Träger gefunden wurde,
endet die Arbeit des Instituts voraussichtlich Ende April 2014.