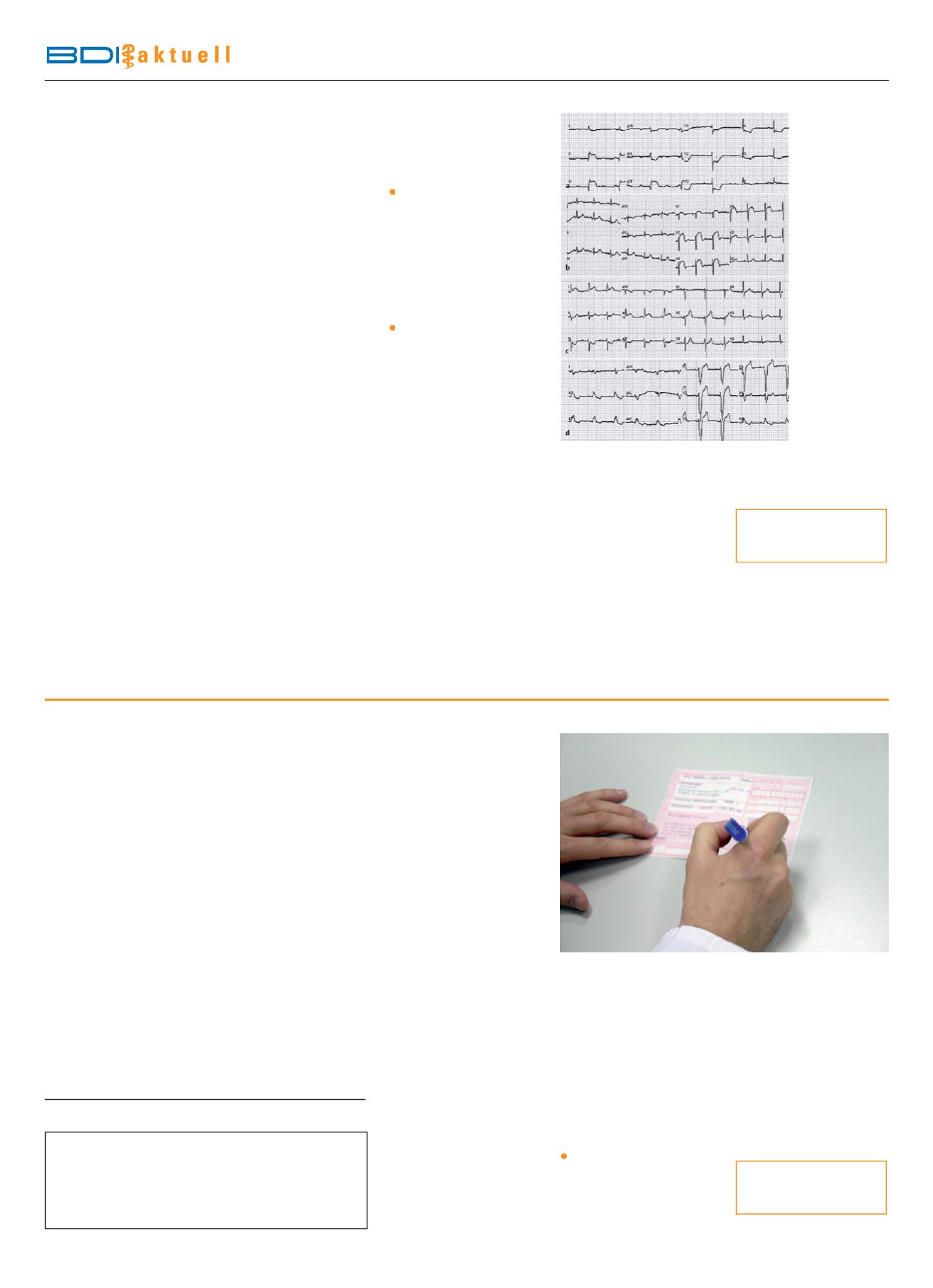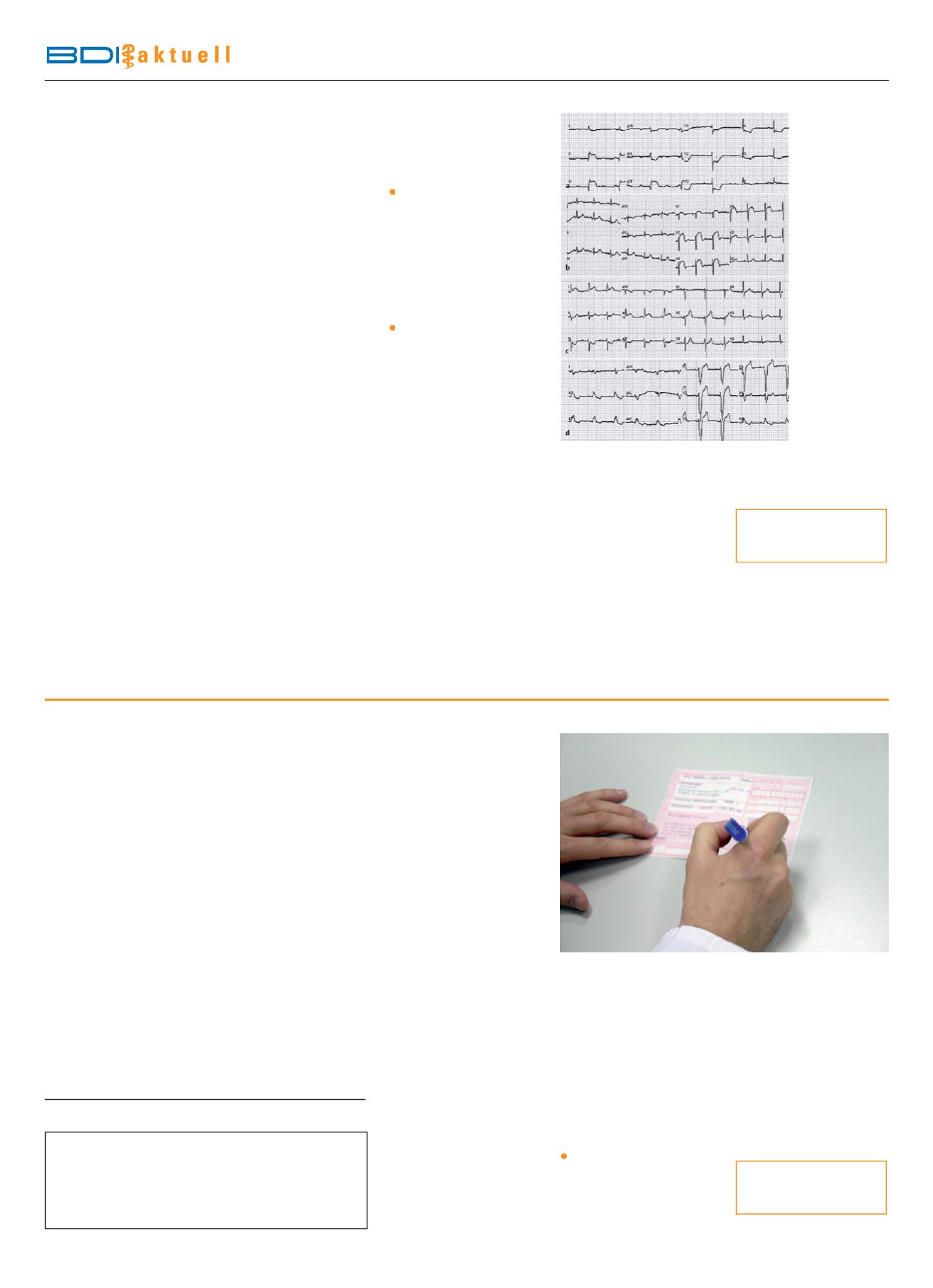
Medizin
Nr. 4 • April 2014
15
Trotz Fortschritten bei der Behandlung
bleibt die Mortalität beim akuten Myo-
kardinfarkt mit kardiogenem Schock
hoch. Die intraaortale Ballongegenpul-
sation ist die am häufigsten angewen-
dete Unterstützungsmethode seit fast
fünf Jahrzehnten. Aufgrund unzurei-
chender und widersprüchlicher Regis-
terdaten wurde das Verfahren jedoch
von den amerikanischen und europäi-
schen Leitlinien als Empfehlung herab-
gestuft.
Die IABP-SHOCK-II-Studie verglich
nach 1:1-Randomisierung von 600
Herzinfarktpatienten mit kardiogenem
Schock und leitliniengerecht optimier-
ter Behandlung (einschließlich früher
Revaskularisation) die zusätzliche
intraaortale Ballongegenpulsation mit
der Kontrollgruppe ohne diese Maß-
nahme. Dabei zeigte sich keine Verrin-
gerung der Mortalität nach 30 Tagen.
Thiele et al. berichten nun über die
Ergebnisse nach 6 und 12 Monaten.
Die Mortalität in beiden Gruppen
unterschied sich nach 6 und 12 Mona-
ten nicht signifikant. Nach 12 Monaten
waren 52% der Patienten mit Ballon-
gegenpulsations-Therapie und 51%
der Kontrollgruppe gestorben (relati-
ves Risiko 1,01; 95%-Konfidenzinter-
vall 0,86–1,18; p=0,91). Es fanden sich
keine signifikanten Unterschiede hin-
sichtlich Re-Infarkten, Schlaganfällen,
erneuter Revaskularisation oder
Implantation von Kardiovertern/Defi-
brillatoren. Die Lebensqualität, gemes-
sen mit dem Euroqol-5D-Fragebogen,
zeigte sich nach einem Jahr als mittel
bis gut und ohne Unterschied zwi-
schen den Gruppen. Auch Subgrup-
penanalysen ergaben gleichlautende
Ergebnisse. Als unabhängige Risikofak-
toren erwiesen sich Alter, Schlaganfall
in der Vorgeschichte, initiale Serum-
laktatkonzentration, Einschränkung
der renalen und mentalen Funktionen,
pH unter 7,36 und Linksschenkelblock
bei Aufnahme.
Fazit
Der Einsatz der intraaortalen Ballon-
gegenpulsation bei Infarktpatienten
mit kardiogenem Schock, die sofort
revaskularisiert werden, reduziert die
Sterblichkeit nach 12 Monaten nicht.
Die Lebensqualität der Überlebenden
war jedoch nach 6 und 12 Monaten
gut.
Kommentar zur Studie
In seinem Kommentar stellt Krischan
D. Sjauw von der Universität Amster-
dam fest, dass diese Studie die Emp-
fehlungen der amerikanischen und
europäischen Fachgesellschaften
untermauert, die die intraaortale
Ballongegenpulsation zu einer Grad
IIaB/IIbB-Empfehlung („kann angewen-
det werden“) zurückgestuft haben. Wo
keine Möglichkeit zur sofortigen
Revaskularisation bestehe, könne aber
die Gegenpulsation weiterhin eine
sinnvolle Ergänzung der systemischen
Thrombolyse sein, auch zur Überbrü-
ckung beim Transport in Zentren. Es
sei wichtig, Patientengruppen zu iden-
tifizieren, die von dem Verfahren pro-
fitieren können und solche, die gefähr-
det werden. Wegen der immer noch
unakzeptabel hohen Mortalität bei
kardiogenem Schock sollten auch noch
leistungsfähigere extrakorporale Herz-
Assistenzsysteme in dieser klinischen
Situation wissenschaftlich erprobt
werden.
Lancet 2013; 382: 1616–1617
Sponsoring: Die Studie wurde von
öffentlichen Institutionen finanziell
unterstützt.
Dr. med. Peter Pommer
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 309).
Alle Rechte vorbehalten.
Die intraaortale Ballongegenpulsation wird seit vielen Jahren bei
kardiogenem Schock zur Stabilisierung des Kreislaufs eingesetzt,
aber erst in den letzten Jahren wissenschaftlich evaluiert. Wie die
meisten Studien, kam die IABP-SHOCK-II-Studie zu dem Ergebnis,
dass die Methode die Mortalität kurzfristig nicht verbessert. Nun
berichten Thiele et al. über Langzeitergebnisse dieser Studie.
Lancet 2013; 382: 1638–1645
Kardiologie
Reduziert intraaortale Ballon-
gegenpulsation Mortalität nach
12 Monaten?
Typische EKG-Veränderungen beim akuten ST-Hebungsinfarkt
(Bildquelle: C.A. Kaiser, M.E. Pfisterer, S. 55 ff, aus Internisti-
sche Notfälle; herausgegeben von Ronald A. Schoenenberger,
Walter E. Haefeli, Jürg A. Schifferli, Thieme Verlag 2009).
Die Verwendung von Betablockern bei
Patienten mit chronisch obstruktiver
Lungenerkrankung (COPD) ist auf-
grund gefürchteter negativer Auswir-
kungen auf die Lungenfunktion limi-
tiert. Quint et al. untersuchten in
einer populationsbasierten Kohorten-
studie (England), inwiefern Betablo-
cker und der Zeitpunkt ihrer Ver-
schreibung Einfluss auf das Überleben
von Patienten mit COPD nach einem
Myokardinfarkt haben.
Die der Studie zugrunde liegenden
Daten stammen aus einem großen
nationalen Register (MINAP), welches
Krankenhausaufnahmen aufgrund
eines Myokardinfarktes oder anderer
akuter koronarer Syndrome aus allen
Kliniken in England und Wales erfasst,
und einer großen Datenbank (GPRD)
mit Daten von etwa 5 Millionen
Patienten aus ca. 625 Allgemeinarzt-
praxen in England. Insgesamt wurden
1063 Patienten mit COPD und Myo-
kardinfarkt in die Studie eingeschlos-
sen. Von diesen nahmen 586 (55,1%)
über den gesamten Studienzeitraum
nie Betablocker, 244 (23%) nahmen
einen Betablocker vor dem Auftreten
des Myokardinfarktes und 233 (21,9%)
erhielten Betablocker nach Klinikauf-
nahme aufgrund des Infarktes.
Die Patienten, bei denen ein Betablo-
cker während des Klinikaufenthaltes
aufgrund eines Infarktes verschrieben
wurden, zeigten einen eindeutigen
Überlebensvorteil (adjustierte Hazard
Ratio [aHR] 0,50; 95%-Konfidenzinter-
vall [KI] 0,36–0,69; p<0,001; mittlere
Nachbeobachtungszeit 2,9 Jahre).
Patienten, welche bereits einen Beta-
blocker einnahmen, hatten ebenfalls
einen Überlebensvorteil (aHR 0,59;
95%-KI 0,44–0,79; p<0,001). Es wur-
den vor allem kardioselektive Betablo-
cker rezeptiert – allen voran Bisopro-
lol (57,5%), gefolgt von Atenolol
(24,9%), Metoprolol (11,4%), Carvedi-
lol (3,6%), Nebivolol (1,0%), Proprano-
lol (2,1%) und Sotalol (0,5%). Todesfäl-
le aus kardialer und nicht-kardialer
Ursache traten bei Patienten, denen
während des Krankhausaufenthalts
ein Betablocker verschrieben wurde
etwa gleich häufig auf wie bei Patien-
ten, denen das Medikament während
dieser Zeit nicht verschrieben wurde
(49% bzw. 51%). In der Studie war die
Schwere der COPD, gemessen an den
GOLD-Kriterien, zwischen den Patien-
ten die einen Betablocker erhielten
und denen, die keinen Betablocker
einnahmen, gleich verteilt.
Fazit
Eine Therapie mit Betablockern ver-
bessert das Überleben von COPD-
Patienten nach einem Myokardinfarkt
signifikant, so die Autoren. Bei fehlen-
der Evidenz einer negativen Auswir-
kung auf die Schwere der COPD oder
vermehrte Exazerbationen sollte ein
Betablocker COPD-Patienten mit Myo-
kardinfarkt nicht vorenthalten werden.
Sponsoring: Die Studie wurde finanziell
nicht unterstützt.
Dr. med. Markus Escher
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2014; 139: 361).
Alle Rechte vorbehalten.
Patienten mit COPD haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre
Ereignisse und eine erhöhte Sterblichkeit nach einem Myokardin-
farkt. Betablocker senken effektiv das Mortalitäts- und Re-Infarkt-
risiko – vermutlich auch bei COPD-Patienten. Quint et al. haben
diesen Zusammenhang genauer untersucht.
BMJ 2013; 347: f6650
Pneumologie – Kardiologie
COPD: Senken Betablocker die
Mortalität nach Myokardinfarkt?
Quint et al. untersuchten unter anderem, welche Rolle der Zeitpunkt der Verschreibung
von Betablockern für das Überleben von Patienten mit COPD nach einem Myokardinfarkt
spielt (Quelle/Fotograf: Thieme Verlagsgruppe/Michael Zimmermann).
Medizin, Zahnmedizin-Studienplätze
deutschsprachig, ohne N.C./Wartezeit
Tel.: 0631/3104 2401
Fax: 0631/3104 2402 Euro-Matrix GmbH
– Anzeige –