Basic HTML-Version
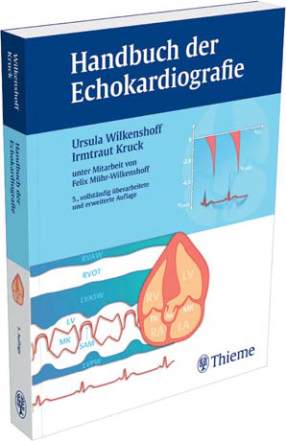
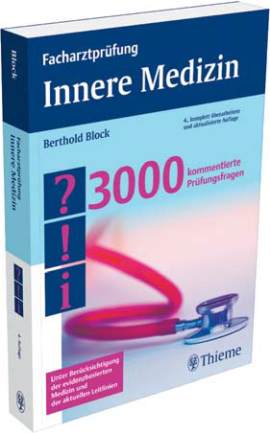

Medizin
Nr. 2 • Februar 2012
16
Organtransplantationen können
für Patienten lebensrettend sein
und ihre Zahl nimmt stetig zu.
Obwohl die Kurzzeit- und die
Langzeit-Überlebenschancen der
Patienten über die letzten Jahr-
zehnte deutlich zugenommen
haben, besteht im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung ein
erhöhtes Erkrankungs- und
Sterblichkeitsrisiko bei Trans-
plantat-Empfängern. E. A. Engels
et al. untersuchten nun speziell
die Häufigkeit von Malignom-
Erkrankungen nach Organtrans-
plantationen.
JAMA 2011; 306: 1891–1901
Für Patienten ist das allgemeine Mali-
gnomrisiko nach einer Transplantation
von Nieren, Leber, Herz und Lunge
deutlich erhöht, so das Ergebnis der
Untersuchung. Dazu wurden Daten des
US-Transplantationsregisters von 1987
bis 2008 ausgewertet und die Verläufe
bei 175 732 Transplantationen über-
prüft. Mehr als die Hälfte davon waren
10 656 Fälle). Am häufigsten vertreten
waren Non-Hodgkin-Lymphome, die
mit Epstein-Barr-Virus-Erkrankungen
in Zusammenhang gebracht werden.
Ähnliche Befunde ergaben sich auch
für andere Malignome, bei denen eine
virale Genese vermutet wird, etwa in
der Leber (persistierende HBV- und/
oder HCV-Infektion). Bei diesen war
das erhöhte Tumorrisiko sogar aus-
schließlich auf Empfänger von Leber-
transplantaten beschränkt. Aber auch
die Häufigkeit von Bronchialkarzino-
men und Nierenzellkarzinomen war
erhöht, am deutlichsten für die jeweili-
gen Transplantat-Empfänger. Die Auto-
ren vermuten als Ursache für das
erhöhte Malignomrisiko zum einen die
durch die notwendigen Immunsup-
pressiva eingeschränkte Abwehrfunkti-
on des Immunsystems gegenüber
onkogenen Viren für Tumoren mit
viraler Genese. Zum anderen spielen
nach ihrer Ansicht vorbestehende Risi-
kofaktoren eine Rolle, wie z.B. Nikoti-
nabusus bei Empfängern von Lungen-
transplantaten oder chronischer
Schmerzmittelgebrauch nach Nieren-
transplantation, denn hier trat der
Nierentransplantationen (58,4 %),
gefolgt von Lebertransplantationen
(21,6 %); auf Herz- bzw. Lungentrans-
plantationen entfielen 10 % bzw. 4 %.
Dabei fand sich für die Transplantat-
Patienten insgesamt eine mehr als
doppelt so hohe Malignomrate wie in
der Allgemeinbevölkerung (insgesamt
Onkologie
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2011; 136: 2530).
Alle Rechte vorbehalten.
3UHLVlQGHUXQJHQ XQG ,UUWPHU YRUEHKDOWHQ /LHIHUXQJ ]]JO 9HUVDQGNRVWHQ %HL /LHIHUXQJHQ LQ >'@
EHWUDJHQ GLHVH ½ SUR %HVWHOOXQJ $E ½ %HVWHOOZHUW HUIROJW GLH /LHIHUXQJ YHUVDQGNRVWHQIUHL
%HL /LHIHUXQJHQ DXHUKDOE >'@ ZHUGHQ GLH DQIDOOHQGHQ 9HUVDQGNRVWHQ ZHLWHUEHUHFKQHW
6FKZHL]HU 3UHLVH VLQG XQYHUELQGOLFKH 3UHLVHPSIHKOXQJHQ
7HOHIRQEHVWHOOXQJ
.XQGHQVHUYLFH
#WKLHPH GH
)D[EHVWHOOXQJ
ZZZ WKLHPH GH
,QQHUH 0HGL]LQ
-HW]W EHVWHOOHQ 9HUVDQGNRVWHQIUHLH /LHIHUXQJ LQQHUKDOE 'HXWVFKODQGV
$OOHV DXI HLQHQ %OLFN
+DQGEXFK GHU (FKRNDUGLRJUDÀH
:LONHQVKRII .UXFN
YROOVW EHUDUE X HUZ $XIO
6
$EE 6SLUDOELQGXQJ
,6%1
ʣ >'@
ʣ >$@ ² &+)
2SWLPDO IU GLH 9HUZHQGXQJ DP 6FKDOOSODW]
,GHDOHU hEHUEOLFN XQG VFKQHOOHU =XJULII
DXI DOOH ZLFKWLJHQ NDUGLRORJLVFKHQ
.UDQNKHLWVELOGHUQ
5DVFK ]X GHQ JHVXFKWHQ ,QIRUPDWLRQHQ
EHUVLFKWOLFK JHJOLHGHUW LQ 0HWKRGHQ
(UNUDQNXQJHQ XQG 1RUPZHUWH
.XU]JHIDVVWH 'HILQLWLRQHQ 6\PSWRPH
$XVNXOWDWLRQVEHIXQGH
XQG (.*
9HUlQGHUXQJHQ
.RQNUHWH (UOlXWHUXQJHQ
]X GHQ
HLQVFKOlJLJHQ HFKRNDUGLRJUDSKLVFKHQ
%HIXQGHQ
$QVFKDXOLFKH *UDILNHQ
XQG SUD[LVEH]RJHQH
'DUVWHOOXQJ GHU 8QWHUVXFKXQJ RSWLPDO DXFK
IU GHQ (LQVWHLJHU
LQ GHU $XIODJH
.RPSOHWW DNWXDOLVLHUW XQG EHUDUEHLWHW
PLW QHXHQ $EELOGXQJHQ
1HXH .DSLWHO
Å6SHFNOH 7UDFNLQJ ,PDJLQJ´
XQG Å%HVWLPPXQJ GHU SXOPRQDODUWHULHOOHQ
'UXFNYHUKlOWQLVVH´
/RFNHU EHU GLH OHW]WH +UGH
)DFKDU]WSUIXQJ
,QQHUH 0HGL]LQ
%ORFN
NRPSO EHUDUE X DNW $XIO
6
$EE NDUW
,6%1
ʣ >'@
ʣ >$@
² &+)
8PIDVVHQG VWUHVVIUHL XQG HIIHNWLY
YRUEHUHLWHQ
'HU NRPSOHWWH 3UIXQJVVWRII
hEHU
)UDJHQ DXV DOOHQ 7KHPHQ
EHUHLFKHQ
GHU ,QQHUHQ 0HGL]LQ
,QKDOWH UHDOHU )DFKDU]WSUIXQJHQ
VLQG NRQVHTXHQW EHUFNVLFKWLJW
6\VWHPDWLVFKHV /HUQHQ XQG
SUD[LVQDKH (UIROJVNRQWUROOH
7HVWHQ GHU 3UIXQJVWDXJOLFKNHLW
GXUFK GLH 3UIXQJVVLPXODWLRQ ]X +DXVH
5HDOLVWLVFKH
(LQVFKlW]XQJ GHV
HLJHQHQ /HLVWXQJVVWDQGHV
9HUQHW]WHV 'HQNHQ
'HU 3UIXQJVWUDLQHU
]HLJW ZLH PDQ )DNWHQ DXV YHUVFKLHGHQHQ
%HUHLFKHQ YHUNQSIW EHZHUWHW XQG ]X
HLQHU NRQNUHWHQ $XVVDJH YHUGLFKWHW
$OOH )UDJHQ NRPSOHWW DNWXDOLVLHUW
XQG PLW QHXHQ $VSHNWHQ HUJlQ]W
=XVlW]OLFKH QHXH )UDJHQ
XQG $EELOGXQJHQ
(UZHLWHUXQJ GHU 'LGDNWLN
%DVLVUHJHOQ DOV
5HWWXQJVDQNHU ZHQQ HLQ VWUHVVEHGLQJWHU
%ODFNRXW GURKW
'LH 6RIRUWKLOIH IU GHQ +DXVDU]W
$OJRULWKPHQ TXLFN
IU GHQ +DXVDU]W
)XUJHU 6FKDXIHOEHUJHU
6 $EE 6SLUDOELQGXQJ
,6%1
ʣ >'@
ʣ >$@
6FKQHOOH /|VXQJ
.RPSDNW DOV )OXVVGLDJUDPP DXI
GDV :HVHQWOLFKH UHGX]LHUW
+LOIHVWHOOXQJ ]X KlXILJHQ NOLQLVFKHQ
6LWXDWLRQHQ
-HGHU $OJRULWKPXV PLW %HJOHLWWH[W
$QVFKDXOLFKH 'DUVWHOOXQJ
(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVH LP
$OJRULWKPXV NODU GDUJHVWHOOW
6FKQHOO HUIDVVEDU ² JXW PHPRULHUEDU ²
HLQIDFK LQWHJULHUEDU
.RQNUHWH 7LSSV
(YLGHQ] EDVLHUWH XQG SUl]LVH
+DQGOXQJVYRUVFKULIWHQ
hEHU KlXILJH 6\PSWRPH GLH ]XP
$U]WEHVXFK IKUHQ ] % URWHV $XJH
6FKXOWHUVFKPHU] $WHPQRW %UXVWVFKPHU]HQ
UHOHYDQWH 6FRUHV ]XU (QWVFKHLGXQJVILQGXQJ
0D[LPDOH 6LFKHUKHLW
.ODUH =XVDPPHQIDVVXQJ YRQ $OJRULWKPXV
XQG .RPPHQWDU
,Q =XVDPPHQDUEHLW PLW %HUQHU ,QVWLWXW
IU +DXVDU]WPHGL]LQ
$ O
Erhöhtes Malignomrisiko
nach Organtransplantation
Kurzmitteilung
Langzeit-Studie weist kein
erhöhtes Hirntumorrisiko durch
Handys auf
Seit Einführung des Mobiltelefons
stehen die beim Telefonieren
erzeugten elektromagnetischen
Strahlen in Verdacht, gesundheits-
gefährend zu sein. Frei et al. vergli-
chen nun in einer landesweiten
Kohortenstudie das Hirntumorrisi-
ko von 358 403 Dänen über 30 Jah-
ren (3,8 Mio. Personenjahre), die
einen Handyvertrag besaßen, mit
solchen ohne Vertrag. In Kombina-
tion mit Daten aus dem dänischen
Krebsregisters (1990–2007) ergab
auch das zweite Update dieser Ana-
lyse kein erhöhtes Hirntumorrisiko
durch das Telefonieren per Mobilte-
lefon. Bei einer Handyvertragspha-
se von
≥
13 Jahren lag die Inzidenz-
rate bei Männern bei 1,03 (95 %-
Konfidenzintervall [KI] 0,83–1,27)
und die bei Frauen bei 0,91 (0,41–
2,04). Für Gliome betrug diese bei
einer Handyvertragsphase
≥
10
Jahre, geschlechtsunspezifisch
1,04, für Meningiome 0,90 (95 %-KI
0,57–1,42) bzw. 0,93 (95 %-KI
0,46–1,87). Gleichermaßen konnte
kein dosisabhängiger Zusammen-
hang der Expositionsdauer oder des
Expositionslocus (Frontallappen)
mit dem häufigeren Auftreten von
Hirntumoren vermerkt werden. Zur
Nutzungsdauer des Mobiltelefons
gab es jedoch keine Daten.
msa
(BMJ 2011; 343: d6387)
überwiegende Teil der Malignome im
verbliebenen eigenen Organ auf.
Fazit
Insgesamt ist das Risiko, an einem
Malignom zu erkranken, für Patienten
nach einer Organtransplantation mehr
als doppelt so hoch wie für die Allge-
meinbevölkerung, so die Autoren.
Dr. med. Elke Ruchalla
Der Beitrag ist erstmals erschienen in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift
(Dtsch Med Wochenschr 2011; 136: 2341).
Alle Rechte vorbehalten.

